Zahnlos in Brüssel
Die Schimäre der EU-Sicherheitspolitik
von Anne-Cécile Robert
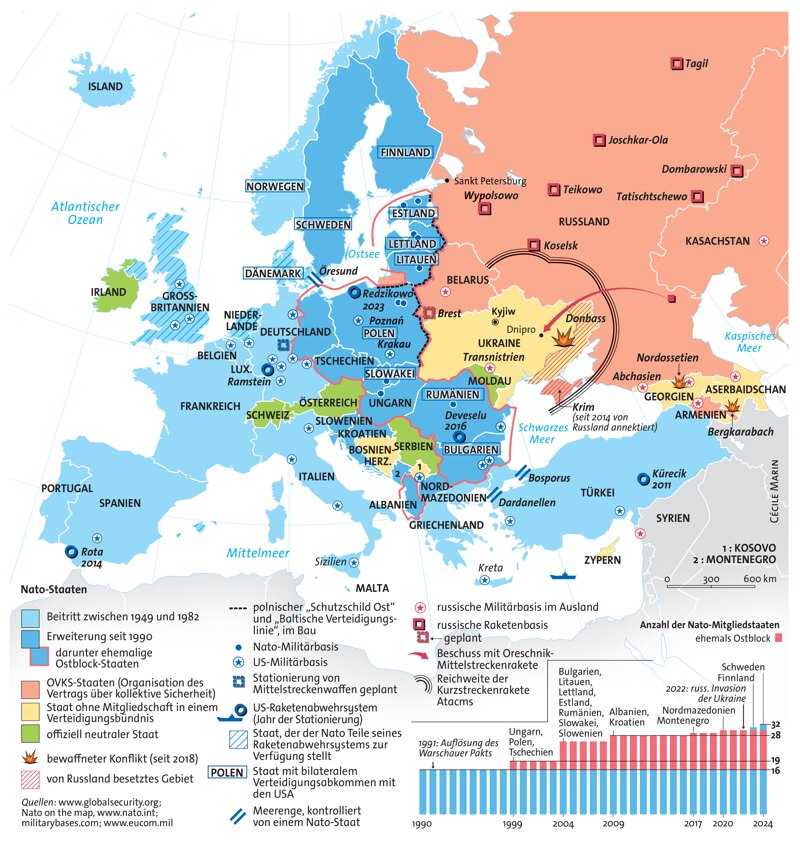
In den Diskussionen über eine gemeinsame europäische Verteidigung kursieren verschiedene Fantasievorstellungen. Eine der kühnsten ist die von einem geeinten Europa, das geschlossen auftritt, um sich gegen geopolitische Bedrohungen zu wehren.
Nur ist die EU in der Welt kein Hauptakteur mehr. Das erste europäische Gipfeltreffen nach der Annäherung zwischen den USA und Russland fand am 2. März 2025 in London statt – obwohl Großbritannien 2020 aus der EU ausgetreten ist. Neben elf EU-Ländern (von 27) nahmen an dem Ukraine-Sondergipfel auch Norwegen und Kanada teil, zudem das Nato-Mitglied Türkei, das seit Jahrzehnten auf seinen EU-Beitritt wartet.
Am 11. März folgte dann in Paris eine Diskussionsrunde über einen möglichen Friedensplan für die Ukraine. Dazu trafen sich 34 Generalstabschefs aus Europa, aber auch aus Kanada und Australien, die sich für eine Vermittlerrolle interessieren.
Die Europäische Union trat erst in Erscheinung, als es ums Geld ging: Am 4. März kündigte die EU-Kommission ein Finanzierungsprogramm von 800 Milliarden Euro an, die für die nationalen Verteidigungsindustrien der EU-Länder gedacht sind. Selbst die legendäre Beschränkung des jährlichen Haushaltsdefizits auf 3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) könnte zum Wohle der Waffenproduzenten abgeschafft werden, heißt es in einem entsprechenden Weißbuch.
Das einleuchtende Ziel, die Abhängigkeit von US-Technologien zu verringern, ist jedoch umso schwerer zu erreichen, als die Zusammenarbeit in der Rüstungsindustrie trotz einiger Erfolge durch gravierende Unstimmigkeiten – nicht zuletzt zwischen Frankreich und Deutschland – belastet ist.
Der jetzt bevorstehende Geldsegen steht in einer Reihe früherer Anläufe. Es begann 2004 mit der Europäischen Verteidigungsagentur (EVA); 2017 folgte die Ständige Strukturierte Zusammenarbeit (SSZ); 2021 der Europäische Verteidigungsfonds (EVF). Im März 2021 wurde die Europäische Friedensfazilität gegründet, die – entgegen ihrem Namen – den Export tödlicher Waffen in Kriegsgebiete finanziert und ein Jahr später aufgestockt wurde, um das Militärpotenzial der Ukraine zu stärken.
Eigentlich hat die Europäische Kommission, was die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP) betrifft, keinerlei Kompetenzen. Sie ist wirtschaftliches Leitorgan des gemeinsamen Marktes und kann außenpolitisch nur sehr begrenzt Einfluss nehmen (etwa über die Handelspolitik), auch wenn der aus den Staats- und Regierungschefs bestehende Europäische Rat (ER) den gegenteiligen Anschein bewusst aufrechterhält. So hat der ER im September 2024 die Kommission mittels einer sehr freien Interpretation der EU-Verträge ermächtigt, einen Kommissar für Verteidigung zu ernennen.
Die strategischen Ziele einer gemeinsamen Außenpolitik müssen letztlich von den Mitgliedstaaten festgelegt werden, wobei das Einstimmigkeitsprinzip gilt. Die Verabschiedung einer echten gemeinsamen Verteidigungspolitik wird dabei, trotz der oben aufgezählten diversen Strukturen, durch die unterschiedliche Geschichte der Länder und divergierende Interessen verhindert. Deshalb kommt es dann jeweils zu Adhoc-Zirkeln wie eben zur Londoner „Koalition der Willigen“ im Fall Ukraine.
Nach dem Trauma der Jugoslawienkriege hat die EU 1993 eine Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) entwickelt, die in eine gemeinsame Verteidigung münden könnte. Mit dieser Perspektive hat sie sich inzwischen mehrere Koordinierungsorgane zugelegt, etwa das Politische und Sicherheitspolitische Komitee (PSK) und den Militärausschuss der Europäischen Union (EUMC). Außerdem betreibt sie fünf Militär- und Ausbildungsmissionen in Bosnien und Herzegowina, in der Zentralafrikanischen Republik, in Mosambik, in Somalia und für die Ukraine.

Inkonsistent und inkonsequent
Dieses institutionelle Gerüst ruht jedoch auf keiner „europäischen Vision“ und trägt auch nicht zur Herausbildung einer solchen Vision bei. Der am 21. März 2022 verabschiedete „Strategische Kompass für Sicherheit und Verteidigung“ beschränkt sich auf einen Zielkatalog im Rahmen der Nato.
Und am 6. März 2025 erklärten die 27 Staats- und Regierungschefs der EU, „dass eine stärkere und fähigere Europäische Union im Bereich Sicherheit und Verteidigung einen positiven Beitrag zur globalen und transatlantischen Sicherheit leisten wird“, allerdings nur in Ergänzung der Nato, die für die dem Bündnis zugehörigen EU-Staaten „nach wie vor das Fundament ihrer kollektiven Verteidigung bildet“.1
Zum Thema Ukraine heißt es, man werde Sicherheitsgarantien nur im Verein „mit gleichgesinnten und Nato-Partnern“ leisten. Dieser ausdrückliche Verweis ist kein leeres Credo, sondern bekräftigt eine maßgebliche Entscheidung. Europa ist ein Produkt des Kalten Kriegs. Oder, um es mit den Worten des Transatlantikers Jean-Louis Bourlanges zu sagen: „Nicht Europa hat den Frieden gemacht. Der Frieden hat Europa gemacht.“2
Dieser Geburtsfehler zeigt sich erneut bei der Ukraine-Debatte in der aktiven Rolle Großbritanniens, das sich als Brücke zu Washington darstellt, und in der Einbeziehung des Nato-Mitglieds Türkei, obwohl sich das Land unter Erdoğan von demokratischen Standards immer weiter entfernt.
Die Aufregung um die „russische Bedrohung“ erzeugt zwar auf die Schnelle eine äußerliche Einheit, kann die Zentrifugalkräfte aber nicht dauerhaft bändigen, die der von anfangs 6 auf 27 Mitglieder erweiterten Union zusetzen.
Während die baltischen Staaten oder Rumänien aus historischen Gründen durch das russische Vorgehen in Unruhe versetzt werden, sorgen sich die Mittelmeerländer um andere Bedrohungen an ihrer Südflanke: Chaos in Libyen, Konflikte zwischen Algerien und Marokko, Spannungen zwischen Griechenland und der Türkei, Migrationsdruck, dschihadistische Netzwerke in Nordafrika.
Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni beschwert sich über mangelnde Solidarität der Union mit ihrem Land, in dem viele Flüchtlinge ankommen, rühmt sich ihrer Nähe zu Präsident Trump und will nichts von europäischer Truppenpräsenz in der Ukraine wissen. Polens Präsident Andrzej Duda dagegen betont stets seine Verbundenheit mit einem „Europa der Nationen und der Traditionen“, ganz wie auch sein slowakischer Amtskollege Robert Fico.
In der EU entstehen immer neue Untergruppen: EuroMed mit den neun Mittelmeeranrainern Zypern, Kroatien, Spanien, Frankreich, Griechenland, Italien, Malta, Portugal und Slowenien; oder die von Polen geführte Drei-Meere-Initiative mit den 13 Mitgliedern Polen, Österreich, Bulgarien, Kroatien, Estland, Griechenland, Ungarn, Lettland, Litauen, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Tschechien.3 Und 2021 haben Paris und Athen einen bilateralen Verteidigungsvertrag unterzeichnet, der offenkundig gegen die Türkei gerichtet ist.
„Die Politik aller Mächte wird von ihrer Geografie bestimmt“, schrieb Napoleon Bonaparte am 10. November 1804 an den König von Preußen. Davon geht auch der Europäische Rat aus, wenn er – wiewohl weniger pointiert – in seiner Erklärung zur Ukraine vom 6. März festhält, „dass jede militärische Unterstützung sowie Sicherheitsgarantien für die Ukraine unter uneingeschränkter Achtung der Sicherheits- und Verteidigungspolitik bestimmter Mitgliedstaaten und unter Berücksichtigung der Sicherheits- und Verteidigungsinteressen aller Mitgliedstaaten erfolgen werden“.4
Auch die Idee eines europäischen Pfeilers der transatlantischen Allianz beantwortet allerdings nicht die Frage: Wozu das Ganze? Die EU hält am Verweis auf die Nato auch deshalb fest, weil er die gespaltenen Mitgliedsländer auf eine gemeinsame geostrategische Linie festlegt, die von Washington vorgegeben wird.5 Außerdem wird so die Festlegung auf eine europäische Führungsmacht vermieden. Denn man wird sich auf keinen der drei Prätendenten – Frankreich, Deutschland und Großbritannien – einigen können, deren jeweilige Großmachtvergangenheit keine guten Erinnerungen weckt.
In der Praxis liegt im Krisenfall das Recht auf Erstreaktion bei der Nato, während die GASP der EU nur eine ergänzende Rolle spielt und meist auf „untergeordnete“ Ausbildungs- oder Krisenbewältigungsmissionen beschränkt bleibt.
Sollten sich die USA unter Trump tatsächlich weitgehend aus Europa zurückziehen, könnte sich allerdings ein strategischen Raum für die EU eröffnen. Zumindest in der Theorie. Der EU-freundliche Politikwissenschaftler Federico Santopinto stellt jedoch die Frage: „Können die stolzen und souveränen Nationen des Alten Kontinents auf Dauer ohne die hegemoniale Präsenz der USA an der Spitze vereint bleiben?“ Seine Antwort lautet: „Die Geschichte lehrt uns etwas anderes.“6
Die unterschiedlichen nationalen Narrative und das Fehlen einer gemeinsamen geopolitischen Kultur lassen eine europäische Einigung als mission impossible erscheinen. Simplifizierende Beschwörungsformeln – geprägt von einer allfälligen Russophobie – erwecken den Anschein von Einigkeit, haben aber mit der Realität nichts zu tun.
„Für Frieden müssen die Unabhängigkeit, Souveränität und territoriale Unversehrtheit der Ukraine geachtet werden“,7 beschwört der Europäische Rat – ungeachtet der offensichtlichen Kräfteverhältnisse vor Ort. Obwohl die Ukraine von Korruption durchsetzt ist, wird sie als Vorposten der „europäischen Werte“ (Rechtsstaatlichkeit, Demokratie) dargestellt. Dabei würde die Berufung auf die völkerrechtlichen Prinzipien ausreichen, um die Unterstützung gegen die russische Aggression zu begründen.
Was fehlt, ist „eine realistische und mutige Analyse“, befindet Santopinto. Eine nüchterne Bestandsaufnahme würde zu dem Eingeständnis führen, dass es aus der aktuellen Sackgasse nur zwei Auswege gibt: „entweder sich noch stärker in dem Konflikt zu engagieren, in der Hoffnung, dass es den Ukrainern gelingt, einen Teil ihres Territoriums zurückzuerobern“; oder „einen Verhandlungskanal zu Russland zu eröffnen“.
Doch die Europäer hätten keinen der beiden Wege eingeschlagen und sich damit „als inkonsistent erwiesen“. Und auch als inkonsequent: Obwohl die Union seit dem Erweiterungsschub von 2004 immer weiter an Russland heranrückt, gibt sie sich überrascht, dass sie nun vor seiner Haustür angelangt ist.
Otto von Bismarck erreichte die Einigung Deutschlands unter der Führung Preußens, indem er Frankreich in den Krieg trieb. Kriege als Vehikel zur Stärkung der Autorität – das ist ein alter Hut, der aber immer noch passt. Schon im September 2008 schrieb der Journalist Jean Quatremer: „Der Krieg oder vielmehr die Möglichkeit eines Kriegs ist die Voraussetzung, um der Union dieselben Mechanismen zu verschaffen, die einst die Herausbildung der Nationalstaaten ermöglicht haben.“8
Heute mehren sich die Stimmen in der Kommission und im Europäischen Parlament, die im Namen der „Effizienz“ fordern, dass die Entscheidungen in Sachen GASP künftig mit qualifizierter Mehrheit getroffen werden. In einer Union ohne politische Substanz würde eine solche sozusagen „bewaffnete“ Europäisierung am Ende zur Etablierung einer autoritären, bellizistischen Bürokratie führen, die nur Schwarz und Weiß kennt.
7 EUCO 10/25 (siehe Anmerkung 4), Punkt 4e.
Aus dem Französischen von Claudia Steinitz
Anne-Cécile Robert ist Redakteurin bei LMd, Paris.




