Wer stimmt für Le Pen?
Neuere Feldstudien brechen mit den üblichen Annahmen über die Wählerschicht der Rechtsextremen in Frankreich
von Benoît Breville
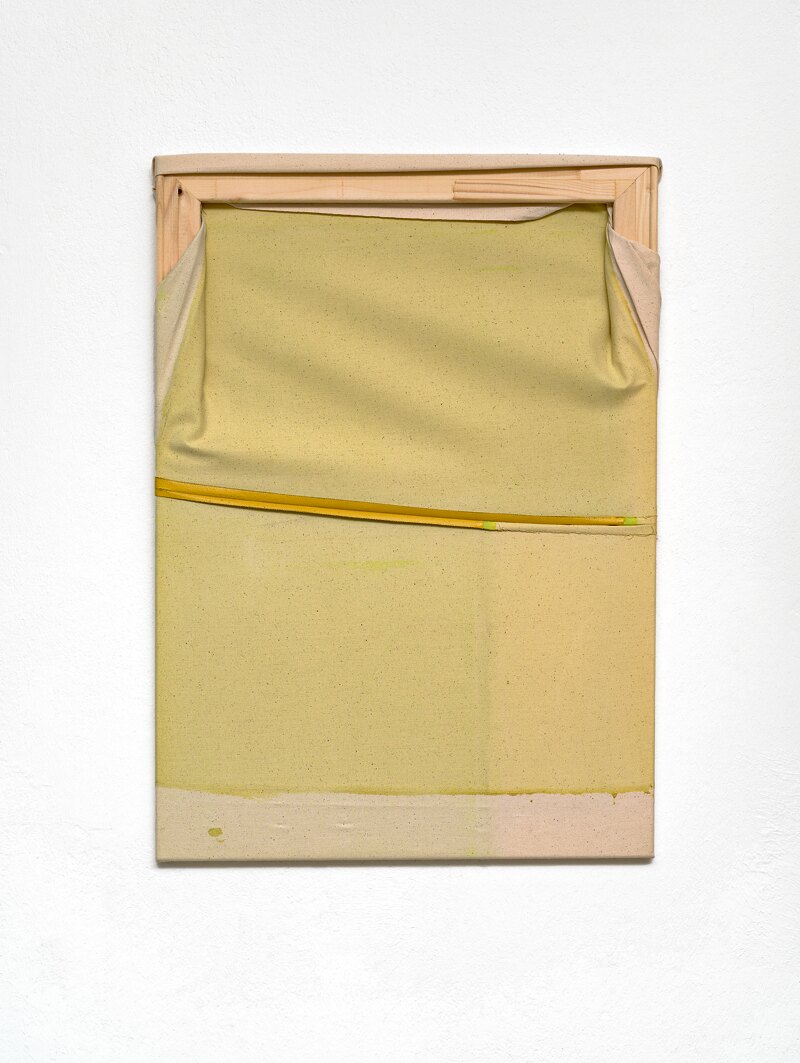
Wer wählt die extreme Rechte und warum? Über dieses Rätsel wurde schon so viel geredet und geschrieben, dass man es für gelöst halten könnte. Seit ihren ersten Wahlerfolgen vor 40 Jahren ist der Front National (FN), 2018 umbenannt in Rassemblement National (RN), „zweifellos die französische Partei, die in den letzten Jahrzehnten am gründlichsten untersucht wurde“, stellt der Politikwissenschaftler Alexandre Dezé fest.1 Zwischen 1980 und 2017 wurden mindestens 210 Bücher zu dem Thema publiziert, und der Strom reißt nicht ab.
Wie lässt sich die Verbreitung der Partei in den verschiedenen Regionen Frankreichs interpretieren? Ist ihr Aufstieg der Beleg für einen allgemeinen Rechtsruck des Landes? Und werden sie aus sozialen oder eher aus kulturellen Beweggründen gewählt?
Tatsächlich begründen die RN-Anhänger:innen ihre Entscheidung nicht alle gleich, und sie fühlen sich auch nicht in gleichem Ausmaß mit der Partei verbunden. Ihre Motivation variiert je nach biografischem Hintergrund, Alter, sozialer und beruflicher Stellung sowie geografischer Herkunft. Man müsste also von den Wählerschaften des RN im Plural sprechen, denn diese Partei durchdringt alle Milieus.
So lag die von Jordan Bardella geführte Liste bei den Europawahlen im Juni 2024 in jeder Berufsgruppe an erster Stelle: mit 53 Prozent bei den Arbeiter:innen, 40 Prozent bei den Angestellten, aber auch mit 20 Prozent bei den Manager:innen.2 Zwar hat der RN seine Basis vor allem in den ärmeren Bevölkerungsschichten mit niedrigem Bildungsgrad, er kann aber auch auf Teile des Bürgertums zählen. Da es unmöglich ist, alle RN-Wähler:innen über einen Kamm zu scheren, fokussieren sich sozialwissenschaftliche Untersuchungen und Wahlanalysen meist auf einen bestimmten Ort oder eine Berufsgruppe. In den Medien sucht man eine so differenzierte Darstellung jedoch meist vergebens.
In den 1990er Jahren machte sich der Sozialgeograf Jacques Lévy einen Namen mit seinem „Urbanitätsgradienten“3 : So sei in den Zentren von Ballungsräumen mit diverser und internationaler Bevölkerungsstruktur der Anteil der FN-Wähler:innen gering, nehme jedoch umso mehr zu, je weiter man sich in dünner besiedelte und homogenere Gegenden begibt, wo die Bindung an lokale Traditionen stärker ausgeprägt sei. Allerdings wurde Lévys These wegen seines fragwürdigen Umgangs mit Statistiken und der Vernachlässigung sozialer Variablen kritisiert und durch zahlreiche Gegenbeispiele entkräftet.
Dennoch erlebte Lévys Theorie einen gewissen Nachruhm durch Anhänger wie Christophe Guilluy, der 2014 mit seinem Buch „La France périphérique“4 einen Verkaufsschlager landete. Er definierte die durchaus reale territoriale Kluft als eine ökonomische: zwischen einem wohlhabenden urbanen Frankreich der Eliten und Globalisierungsgewinner auf der einen Seite und dem peripheren Frankreich auf der anderen Seite, das – weit entfernt von den Arbeitsmärkten der Ballungsgebiete und besonders stark betroffen von der Deindustrialisierung – mehrheitlich für die extreme Rechte stimme.
Verschiedene Experten hielten Guilluy vor, dass er die ländlichen und kleinstädtischen Gegenden Frankreichs in einen Topf werfen und ein übertrieben düsteres Bild zeichnen würde, wohingegen er die Lage in den Banlieues beschönige. So wiesen einige Studien darauf hin, dass die freie Entscheidung für ein angenehmes Leben im Umland – zum Beispiel mit einem schönen großen Garten – die Wahl der extremen Rechten nicht begünstigt.5 Ein Abgleich zwischen den umfangreichen Daten aus den Wahllokalen kam beispielsweise zu dem Ergebnis, dass der Wohnort die Wahlentscheidung viel weniger stark beeinflusst als Alter, Bildungsabschluss oder Beruf. Dem Geografen Jean Rivière zufolge, der die Metropolregion Nantes untersuchte, sind „die Veränderungen bei den Wahlen eng an die soziologische Entwicklung der Stadtviertel gekoppelt“.6
Die Auflösung von Wählerblöcken und die politische Dreierformation, die sich durch den Sieg von Emmanuel Macron bei den Präsidentschaftswahlen 2017 ergab, haben Guilluys Theorie zwar etwas erschüttert, aber er bleibt dabei: „Es gibt nicht drei Blöcke, sondern zwei, die Metropolen gegen das periphere Frankreich“, erklärte er noch am Tag nach der zweiten Runde der Parlamentswahlen in Le Figaro am 15. Juli 2024.
Auf dem Markt für Wahlanalysen bekommt Guilluy neuerdings Konkurrenz von Jérôme Fourquet, dem Direktor des Meinungsforschungsinstituts Ifop. In der Trilogie „L’Archipel français“ (2019), „La France sous nos yeux“ (2021) und „La France d’après“ (2023) korrigiert er einige Fehlannahmen früherer Studien. Nach der Auswertung verschiedener Variablen entsteht ein Bild von Frankreich, das sich nicht in zwei Hälften teilt, sondern „archipelisiert“ ist – in Gruppen, die in verschiedenen Gegenden wohnen und weder die gleichen Lebensweisen noch die gleichen Weltanschauungen teilen.
In Bordeaux oder Grenoble ging bei den Kommunalwahlen 2020 eine hohe Dichte an Bioläden, Starbucks, Frühstückskneipen und trendigen Restaurants mit einem hohen Stimmenanteil für die Grünen einher. Im Elsass konzentrieren sich die Vereine für Country- und Westerntänze vor allem im städtischen Umland, wo der RN besonders stark ist; wohingegen die Linke ihre besten Ergebnisse in den Banlieues von Straßburg, Mulhouse und Colmar erzielte – alle drei Städte haben eine hohe Kebab-Imbiss-Dichte. Selbst Kaffeekapseln und -pads sind politisch: So erfährt man in „La France d’après“, dass Besitzer von Kaffeekapselautomaten bei den Präsidentschaftswahlen 2022 eher für Emmanuel Macron gestimmt haben, wohingegen Wähler:innen, die die preiswerteren Pads benutzen, Marine Le Pen präferierten.
Aus solchen Beobachtungen schließt Fourquet, dass sich die extreme Rechte an die Absteiger der Konsumgesellschaft richtet. Allerdings verwechselt er parteipolitische Strategie mit Product Placement und gesellschaftliche Gruppen mit Marktsegmenten. Obwohl er zahllose Variablen verwendet, korreliert er in der Regel nur zwei oder drei. Der Vergleich einiger weniger geografischer Gebiete dient ihm dann als Beweis für seine Annahmen.
So gibt es bei Fourquet nur eine Erklärung dafür, dass Le Pen 2022 in Kleinstädten mit vielen Windrädern auf den umliegenden Feldern in den Departements Somme (ganz im Norden) und Aude (ganz im Süden) „mit ein paar Prozentpunkten führte“: Umweltpolitische Maßnahmen treiben der extremen Rechten die Wähler:innen in die Arme.
Wenn er die Immobilienpreise und die Präsenz afrikanischer Geschäfte gegenüberstellt, um die Kluft zwischen dem Pariser Stadtteil Montmartre (pro Macron) und dem migrantischen Viertel Goutte d’or (pro Mélenchon) zu veranschaulichen, reproduziert er auf nachgerade karikaturistische Art und Weise das Klischee von den reichen Weißen und armen Migrant:innen.
Betrachten wir diese beiden Beispiele im Lichte neuerer Forschungsarbeiten:7 Bei der Windkraft in der Region Hauts-de-France, zu der auch das Departement Somme gehört, zeigen die soziodemografischen Daten der betroffenen Gebiete, dass hier überdurchschnittlich viele Arbeiter:innen, prekär Beschäftigte und Personen ohne Schulabschluss leben, die ohnehin eher zur Wahl des RN neigen.
Hinzu kommt, dass die Windparks offensichtlich immer häufiger in Regionen angelegt werden, wo die Regeln für die Flächennutzung sukzessive abgebaut wurden. Das heißt, es herrscht gerade dort Rechtsunsicherheit, wo Betroffene nicht über die Mittel verfügen, sich gegen die aggressive Verkaufspolitik der Grundstücksmakler zu wehren. Aus dieser Perspektive sind die vielen Stimmen für den RN eher ein Symptom für den Umgang mit ärmeren Regionen als Ausdruck einer grundsätzlich antiökologischen Einstellung.
In Bezug auf das 18. Arrondissement, in dem sowohl der Montmartre als auch die Goutte d’Or liegen, wählt Fourquet die Variablen so aus, dass arme Migrant:innen zwangsläufig für Mélenchon stimmen und wohlhabende Bürger:innen für Macron. Eine Studie über einen sozialen Brennpunkt im Norden von Paris, dessen Bevölkerungsstruktur der von Goutte d’Or ähnelt, zeigt indes etwas anderes.8 Im ersten Wahlgang der Präsidentschaftswahlen 2017 stimmten 13,7 Prozent in dem betreffenden Viertel für Le Pen, fast dreimal so viel wie der Pariser Durchschnitt. Darunter finden sich viele Weiße, die den Niedergang ihres Viertels beklagen und die Verantwortung dafür pauschal „Ausländern“ und Muslimen zuschreiben.
Dabei wählen auch Migrant:innen aus dem Maghreb oder dem subsaharischen Afrika den RN, wie zum Beispiel Abdelmalik aus der algerischen Kabylei, der eine Invalidenrente bezieht und für den „Islamisten“ ein Graus sind, oder die Sekretärin Nadine, Katholikin aus der Demokratischen Republik Kongo. Mit ihrer demonstrativen Sympathie für den RN setzen beide darauf, sich von anderen Nichtweißen abzuheben, betonen ihre erfolgreiche Integration und möchten beweisen, dass sie auf „der richtigen Seite“ stehen.
„Unwahrscheinliche Fälle“ wie die von Nadine und Abdelmalik zeigen, dass Abgrenzung anscheinend ein starkes Motiv ist, den RN zu wählen – sei es wegen lokaler sozialer Konflikte oder individueller Erfahrungen, die von pauschalen Vergleichen gar nicht erfasst werden können.
Mit Infografiken zu Übergriffen auf Ärzte und Feuerwehrleute, zur Anzahl von Einbrüchen, zu Drogenumschlagplätzen oder der Häufigkeit und Verortung muslimischer Vornamen vermittelt Fourquets Buch den Eindruck, dass Frankreich mit zunehmender Einwanderung immer weiter nach rechts rückt und sich zunehmend verbarrikadiert. Doch Vincent Tiberj, ein auf Wählerstudien spezialisierter Soziologe, glaubt nicht daran.
Tiberj hat Dutzende von Meinungsumfragen ausgewertet, wobei er die weniger seriösen aussortierte, um herauszufinden, wie sich die Ansichten der Französinnen und Franzosen zu bestimmten Themen und über einen längeren Zeitraum hinweg verändert haben.9 Laut Tiberj ist der „französische Rechtsruck“ nichts anderes als ein „Mythos“. Und mehr noch: Das Land sei sogar toleranter und progressiver in Bezug auf Sexualität, Religionen, Einwanderung oder Gleichberechtigung von Mann und Frau geworden.
So hielten 1981 nur 29 Prozent der Befragten Homosexualität für eine „akzeptable Art, seine Sexualität auszuleben“, 1995 waren es 62 Prozent und seit Beginn dieses Jahrhunderts liegt der Anteil bei 90 Prozent. 1992 bejahten 44 Prozent der Befragten, dass Einwanderer eine „kulturelle Bereicherung“ für das Land seien, drei Jahrzehnte später waren es 76 Prozent.
Bestätigt wird Tiberjs Beobachtung vom Politikwissenschaftler Luc Rouban10 , dessen „Index der Alterität“ nahelegt, dass selbst RN-Wähler:innen toleranter geworden sind. Dass ihr Wahlverhalten vor allem von sozialen Sorgen beeinflusst wird, belegt Rouban mit dem „Barometer“, das 2022 von dem Pariser Forschungsinstitut Cevipof (Centre de recherche politiques de Sciences Po) erstellt wurde: 38 Prozent der RN-Wähler:innen fürchteten, dass ihr Einkommen nicht reicht, wohingegen 18 Prozent das Thema Einwanderung umtreibt.
Aber warum spiegelt sich dieser gesamtgesellschaftlich progressive Trend nicht auch an den Wahlurnen wider? Laut Tiberj liegt das an der „großen Enthaltung“; zu viele Wähler:innen würden auf ihr Stimmrecht verzichten. Das treffe vor allem für junge, progressive Menschen zu, die damit ihre Distanz zum parteipolitischen Angebot demonstrierten.
Die konservative, oftmals ältere Wählerschaft sei dagegen durch die reaktionäre Rhetorik in den Medien leichter zu mobilisieren. Demnach würde die Zeit der Linken in die Hände spielen. Es müsste gar keine Überzeugungsarbeit mehr geleistet werden. Man bräuchte nur abzuwarten, bis die jüngere Generation die Boomer ablöst und die von der Politik Enttäuschten wieder mobilisiert, etwa indem die direkte Demokratie durch Volksabstimmungen auf allen Ebenen gefördert wird.
Diese hauptsächlich auf Umfragen basierende Analyse hat allerdings Schwachstellen, wie man an folgender Entwicklung sieht: Vor mehr als 20 Jahren stimmten im zweiten Wahlgang der Präsidentschaftswahlen 2002 noch 7 Prozent der 18- bis 24-Jährigen für Jean-Marie Le Pen. 2022 hat die gleiche Kohorte, jetzt 38 bis 44 Jahre alt, zu 47 Prozent für seine Tochter Marine Le Pen gestimmt – weit mehr als die 65- bis 79-Jährigen (29 Prozent). Die Zeit spielt also offenbar keine Rolle, und die Aussichten sind umso düsterer, als der RN nun von einem sehr hohen Niveau aus startet: Immerhin 32 Prozent der 18- bis 24-Jährigen gaben 2022 ihre Stimme Le Pen.
Es gibt auch keine Anzeichen dafür, dass sich Linke massenhaft enthalten würden. Für einige Banlieues mag dies zutreffen, doch anderswo scheint es eher zweifelhaft. Umfragen zufolge sind viele, die sich irgendwann entschlossen haben, beim RN ihr Kreuzchen zu machen, vorher nicht wählen gegangen. Das soziologische Profil der Nichtwähler:innen ähnelt überdies dem der RN-Wähler:innen: häufig aus einfachen Schichten stammend, wenige Akademiker:innen. Eine höhere Wahlbeteiligung würde daher keineswegs automatisch der Linken zugutekommen. Im Übrigen erzielt der RN oft seine besten Ergebnisse bei den Wahlen mit der höchsten Beteiligung, etwa bei den Präsidentschaftswahlen.
Auch bringt es nichts, Umfragen anzuhäufen, wenn man die politischen Dynamiken erfassen will, die dazu führen, dass sich bestimmte Einstellungen verändern. Dies gilt insbesondere für die Art und Weise, wie die extreme Rechte bestimmte Themen gegeneinander ausspielt wie Einwanderung und Islam gegen den Schutz von Frauen und Homosexuellen. Zudem ist der soziale Wandel fließend; kaum ist die Auseinandersetzung um ein bestimmtes Thema beigelegt, taucht ein neuer Streitpunkt auf. So findet das konservative Lager immer einen Gegenstand, an dem es seine kulturelle Polarisierung aufhängen kann.
Die Politikwissenschaftler Matt Grossmann und David A. Hopkins haben dies in den USA beobachtet, wo die Republikaner ihre Angriffe gegen Homosexuelle zurückgefahren haben und dafür Transgender, Wokismus und Cancel Culture ins Visier nehmen. Laut Grossmann und Hopkins kann sich dieses Muster im Laufe der Jahrzehnte wiederholen: „Zunächst bekunden die Konservativen ihren Ärger über aktuelle kulturelle Veränderungen, während die Progressiven sie verteidigen, als ob es sich um allen gemeinsame Werte handelte. Dann arrangieren sich die Konservativen allmählich mit diesem Wandel, akzeptieren die veränderten Normen, und die Progressiven können ihre Ansichten als neuen Konsens etablieren – auch wenn sie auf dem Weg dorthin viele Wahlen verlieren.“11
Ist Frankreich also in Wahrheit viel toleranter und weniger rassistisch, weil die RN-Wähler:innen eigentlich nur soziale Sorgen umtreiben? Die Feldstudie, die der junge Soziologe Félicien Faury zwischen 2016 und 2022 in mehreren Kleinstädten in der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur gemacht hat, kommt zu einem anderen Ergebnis: Der Rassismus vermischt sich nicht nur mit der Klassenverachtung gegenüber ärmeren Minderheiten, er verschärft diese sogar.12
So verweisen RN-Anhänger:innen – aber nicht nur sie – in Faurys Protokollen regelmäßig auf „die Araber“, „die Türken“ oder „die Muslime“, wenn sie sich über Missstände beklagen, egal ob es sich um fehlende Krippenplätze handelt, die Verschlechterung des Schulangebots, das Verschwinden alteingesessener Geschäfte in den Innenstädten, Probleme beim Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen oder den Rückgang der Kaufkraft. Und die Steuern seien auch nur deshalb so hoch, weil „diese Nichtsnutze“ alimentiert werden müssten.

Rassismus mischt sich mit Klassenverachtung
„Die Stärke der extremen Rechten beruhte nicht darauf, ein einziges Thema, nämlich Einwanderung, in der öffentlichen Debatte zu verankern, sondern dass sie unablässig Zusammenhänge konstruiert haben zwischen diesem Thema und einer immer länger werdenden Liste sozialer, wirtschaftlicher und politischer Missstände“,13 erklärt Faury, der die Aussagekraft von Wahlumfragen zu den dringlichsten Anliegen und Sorgen stark bezweifelt.
In seiner Feldstudie trifft Faury auf einen allgegenwärtigen Rassismus, den er aber nicht als „abstrakten Hass auf das Fremde“ bezeichnen würde. Hier vermischen sich vielmehr rassistische Ressentiments mit ökonomischen Interessen. Faurys Untersuchungsgegenstand ist nämlich nicht wie in so vielen anderen Studien eine deindustrialisierte Region im Niedergang, sondern ein prosperierendes Umfeld mit florierendem Tourismus und anderen Dienstleistungen, das sich jedoch durch einen aufgeheizten Immobilienmarkt und wachsende Ungleichheit stark unter Druck sieht.
Hier stimmen vor allem die untere Mittelschicht und Rentner:innen für den RN, wobei bestimmte Branchen wie Handwerk, Handel und Sicherheitsgewerbe deutlich überrepräsentiert sind. Diese Wähler:innen sind nicht von Arbeitslosigkeit bedroht, empfinden ihre Situation aber als unsicher und sehen sich im „falschen Milieu“: nicht reich genug für ein sorgenfreies Leben, aber auch nicht arm genug, um von der öffentlichen Unterstützung zu profitieren. Ihrer Meinung nach zahlen sie nur ein und würden nichts dafür bekommen. So entsteht ein neues Misstrauensverhältnis gegenüber den Institutionen und generell dem Wohlfahrtsstaat, der als ungerecht und schwach wahrgenommen wird, weil er immer „die anderen“ bevorzuge gegenüber „denjenigen, die es wirklich verdienen würden“.
Diese Beobachtung hat die Soziologin Clara Deville auch im Libournais gemacht, einer ländlichen Region in der Nähe von Bordeaux, wo sie Sozialhilfeempfänger:innen bei Behördengängen begleitet hat.14 Geschlossene Schalter, Digitalisierung und penible Kontrollen führen zu einer Art „administrativen Stress“, der sich in Vorurteilen entladen kann, wie bei dem Mann, der behauptete, „Schwarze und Araber“ würden besser dastehen als er: „Sie werden mich für einen Rassisten halten. Bin ich aber nicht. Es ist nur so, dass ich bei der Kindergeldkasse die Schwarzen und so in der Schlange stehen und ihre Forderungen stellen sehe.“ So trägt die Diskriminierung bestimmter Minderheiten dazu bei, dass sich ihre Stigmatisierung noch verstärkt.
In der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur klagen die Leute gegenüber Faury außerdem über Wohnprobleme. Viele RN-Anhänger:innen behaupten, es gebe entweder nur noch unerschwingliche oder unattraktive Viertel. Sie haben Angst davor, dass sich ihre Wohnsituation verschlechtert – wobei ein Umzug in eine Sozialbausiedlung am Stadtrand offensichtlich als weniger schlimm empfunden wird als „der Zuzug von neuen Bewohnern mit Migrationshintergrund im Nachbarviertel oder, schlimmer noch, im eigenen Quartier“, berichtet Faury. So kann die Eröffnung eines Cafés ohne Alkoholausschank monatelang für Gesprächsstoff sorgen.
Faurys Sicht „von unten“ auf die Normalisierung des RN überschneidet sich mit einigen Beobachtungen, die der Soziologe Benoît Coquard in den deindustrialisierten ländlichen Regionen in Ostfrankreich gemacht hat.15 Auch hier hat die extreme Rechte eine große Anhängerschaft, insbesondere unter Arbeiter:innen, prekär Beschäftigten und jungen Erwachsenen.
Sowohl im Osten als auch in der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur ist das Kreuz beim RN keine Abweichung mehr von der Norm, für die man sich eventuell schämt und die man lieber nicht zu laut hinausposaunt. Ganz im Gegenteil, man ist sogar stolz darauf, den RN zu wählen, weil man damit zeigt, dass man nicht „auf Stütze“ angewiesen ist, kein „Sozialfall“ und „Faulenzer“ ist und keiner von denen, „die vom System profitieren“.
Jeder kennt Freunde, Nachbarn, Verwandte oder Geschäftspartner:innen, die auch den RN wählen: In dieser Gemeinsamkeit liegt eine sich selbst verstärkende Dynamik, was sich gegenüber den Feldforschern Faury und Coquard häufig in Sätzen wie diesen äußert: „Alle hier denken so“, „jeder wird Ihnen das Gleiche sagen“, „ich bin nicht allein mit meiner Meinung“.
„Die Wahl des RN, bei der eine wachsende Zahl von Wähler:innen mitmacht, kann daher nicht mehr als pathologisch, sondern als ‚logisch‘, nicht mehr als extrem, sondern als ‚ganz normal‘ gelten“, stellt Faury fest, und Coquard kann das nur bestätigen: „Sich offen ‚pro Le Pen‘ auszusprechen, ist hier eine legitime Positionierung, die problemlos öffentlich vertretbar ist.“
Für diejenigen, die sich als links bezeichnen, gilt das indes nicht. Auf dem ostfranzösischen Land provozieren sie leicht „Kritik und Spott wegen angeblicher Faulheit oder Naivität“. Linke – in dieser Gegend ohnehin kaum präsent, insbesondere weil Leute mit höheren Bildungsabschlüssen in die Großstädte abwandern – werden entweder als Klüngel lokaler Eliten oder als Pariser Schwätzer betrachtet, die ein bequemes Leben führen, es sich aber herausnehmen, in einer Mischung aus Heuchelei und Selbstgefälligkeit anderen „Lektionen zu erteilen“. Im Visier stehen vor allem Lehrer:innen, Wissenschaftler:innen, Künstler:innen, Journalist:innen, aber auch die Arbeiter:innen lokaler Genossenschaftsbetriebe und leitende Angestellte im öffentlichen Dienst, sprich die kleine Bildungselite.
Um eine Schlacht zu gewinnen, müsse man nicht nur seinen Gegner, sondern auch sich selbst kennen, schrieb einst der chinesische General Sunzi. Auf die Linke bezogen wäre es wünschenswert, es gebe mehr Bücher über sie und ihre Anführer:innen, Aktivist:innen und Wähler:innen, um zu verstehen, wie es dazu kam, dass sich diese progressive Bewegung so sehr von den einfachen Leuten entfremden konnte.
9 Vincent Tiberj, „La Droitisation française. Mythe et réalités“, Paris (PUF) 2024.
Aus dem Französischen von Nicola Liebert




