Ein geopolitischer Kampfbegriff
Was steckt hinter dem Sprechen von der regelbasierten internationalen Ordnung?
von Anne-Cécile Robert
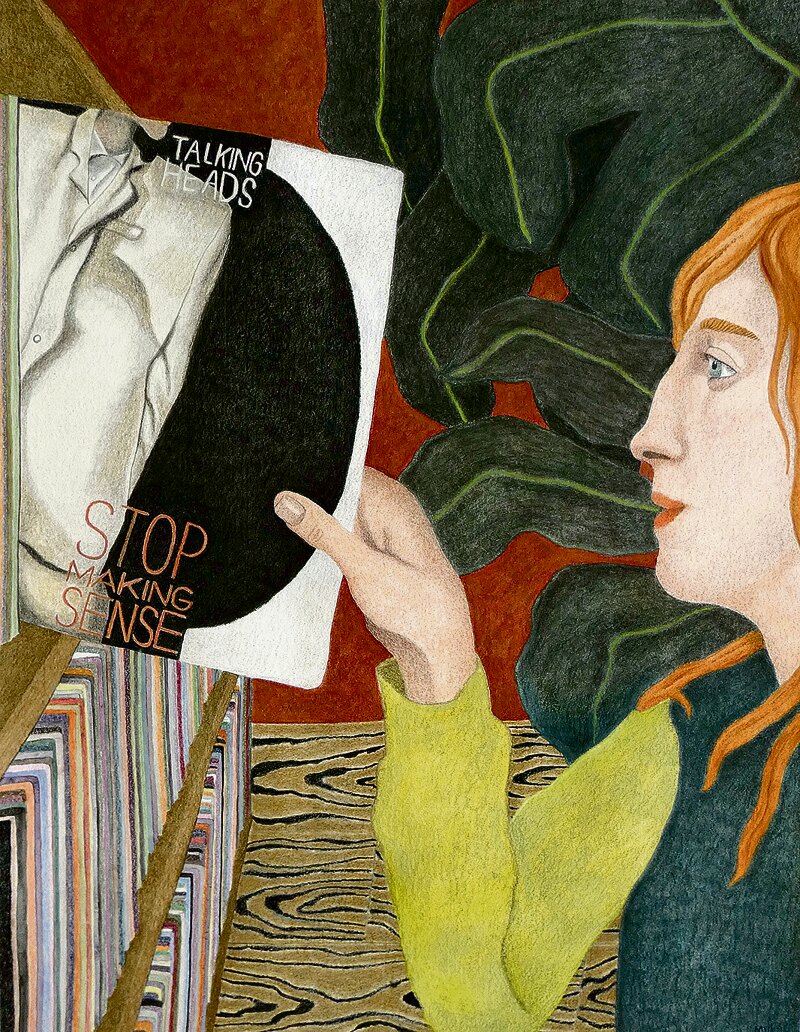
Diplomatische Vertreter der USA greifen immer häufiger auf einen neu eingeführten Begriff zurück: Sie sprechen von „rules-based order“, also einer „regelbasierten Ordnung“, die es angesichts der Gefahren für den Weltfrieden unbedingt zu verteidigen gelte.
Im Westen wird der Begriff im Chor – wie durch einen Pawlow’schen Reflex ausgelöst – allerorten nachgesungen. Im Oktober 2021 erklärten die Regierungen in Washington und Paris ihr Engagement für „die weitere Kooperation zwischen den USA und der EU, um die multilaterale regelbasierte Ordnung zu stärken“.1 Die EU selbst verabschiedete im März 2022 ihren Strategischen Kompass, der auf die „Aufrechterhaltung der internationalen regelbasierten Ordnung“ ausgerichtet ist. Die EU erklärt darin auch ihre Absicht, nicht nur mit strategischen Partnern zusammenzuarbeiten, sondern auch „maßgeschneiderte bilaterale Partnerschaften mit gleichgesinnten Ländern“ zu entwickeln.
Auf den ersten Blick gibt es gegen diese Formeln nichts einzuwenden: Wer will schon gegen eine regelbasierte Ordnung sein, wer würde Unordnung und Chaos besser finden als Frieden und Stabilität auf rechtlich abgesicherter Basis? Der Begriff kann allerdings auch eine Kluft innerhalb der internationalen Gemeinschaft aufreißen – jedenfalls dann, wenn er den Begriff „Völkerrecht“ ersetzt, auf den sich zu berufen jahrzehntelang internationaler Konsens war.

Das Konzept der regelbasierten Ordnung wurde von Staaten geprägt, die sämtlich zur westlichen Welt gehören. Der Begriff bescheinigt implizit diesen Staaten, dass sie auf der richtigen Seite stehen: auf der Basis der positiven Werte von Recht und Ordnung.
Im Gegensatz zum Begriff des Völkerrechts ist der Inhalt dieses neuen Konzepts jedoch uneindeutig. „Die Auffassungen von regelbasierter Ordnung, wie sie die USA, Australien, Deutschland oder Indien vertreten, unterscheiden sich erheblich voneinander“, befindet der Schweizer Politologe Boas Lieberherr. Zwar gehen sie übereinstimmend davon aus, dass eine internationale regelbasierte Ordnung die Staaten verpflichtet, sich an ein gemeinsam vereinbartes Regelwerk zu halten, interpretieren aber unterschiedlich, „was die Regeln genau beinhalten“.3 So gehört etwa für Deutschland und Frankreich wie auch für die gesamte EU die Charta der Vereinten Nationen dazu, für andere Staaten wie Australien aber nicht unbedingt.
Zu dieser Ordnung gehören nach Ansicht ihrer Verfechter sämtliche Regeln, einschließlich der informellen, die das Ensemble der internationale Rechtsordnung bilden. Damit wären auch Problemfelder abgedeckt, die in völkerrechtlichen Abkommen oder Normen noch nicht ausreichend berücksichtigt sind: Bereiche wie Digitalisierung, künstliche Intelligenz, Umweltschutz und Pandemien.
Probleme wie diese anzugehen, ist heute dringlicher als noch vor zehn Jahren, weil es immer mehr Akteure gibt, etwa transnationale Unternehmen, die mächtiger sind als manche Länder und pharmazeutische Labore, weltumspannende soziale Netzwerke und private Sicherheitsfirmen betreiben.
Die mangelnde Regulierung in diesen Bereichen bedeutet eine Gefahr für die Staaten (wie auch für ihre gemeinsamen Institutionen) und somit für deren Bevölkerung. Die regelbasierte Ordnung ist als rechtlicher Rahmen für diese sich laufend verändernden Bereiche gedacht. Und doch bleiben ihre Konturen unscharf: Es hat noch keine internationale Konferenz stattgefunden, um ein Dokument auszuarbeiten, das ihre Leitlinien und Grundprinzipien umfassend formulieren würde.
Noch problematischer ist, in geopolitischer Hinsicht, dass das Konzept einer internationalen regelbasierten Ordnung die Bedeutung entwertet, die bisher für die – zumindest theoretisch – allgemein akzeptierte Berufung auf Abkommen, Resolutionen internationaler Organisationen und auf die Rechtsprechung der internationalen Gerichtshöfe galt.
Dagegen beruft sich das Konzept der regelbasierten Ordnung auf alle möglichen Dokumente von unterschiedlicher rechtlicher Qualität. Dabei sei dessen Verhältnis zum Völkerrecht noch gar nicht erforscht, schreibt der Völkerrechtler John Dugard von der Universität Cambridge. Bislang habe man sich damit begnügt, „die rechtsverbindlichen Normen der Abkommen irgendwie mit den Werten, die ihnen zugrunde liegen, in Verbindung zu bringen“. Und niemand gehe der Frage nach, „ob regelbasierte Ordnung und Völkerrecht kompatibel sind und was von beiden Vorrang hat“.4
Die Kluft zwischen beiden scheint man in europäischen Diplomaten- und Regierungskreisen nicht wahrzunehmen. Häufig wird die Frage nach potenziellen Widersprüchen nicht einmal begriffen. Vonseiten der Regierungen bekommt man als Antwort lediglich den Verweis auf Erklärungen und offizielle Beschlüsse der EU oder ihrer Mitgliedstaaten und auf die UN-Charta.
Aber immerhin das. Anders in den USA und in Australien: Barack Obama wie Joe Biden haben es fertiggebracht, lange Reden über die internationale regelbasierte Ordnung zu halten, ohne die UN-Charta, auf der die internationalen Ordnung ja basiert, oder den Begriff Völkerrecht auch nur zu erwähnen.
Präsident Biden stellte in einem langen Gastbeitrag in der New York Times vom 2. Juni 2022 die Strategie vor, mit der er der Ukraine zum Sieg verhelfen wollte. Dabei wertete er den russischen Überfall auf die Ukraine als Angriff auf die rules-based order – statt ihn klar und eindeutig als Verstoß gegen die UN-Charta zu verurteilen. Auch nach dem Nato-Gipfel von 2022 in Madrid redete Biden vor der Presse ausführlich darüber, ohne das Wort „Völkerrecht“ in den Mund zu nehmen.
All dies bringt den Völkerrechtler Dugard zu der Überzeugung, dass der Begriff „regelbasierte Ordnung“ eine bewusste geopolitische Entscheidung impliziert, wie die USA die Beziehungen zu ihren Partnern – und auch zu ihren Gegnern oder Konkurrenten – zu gestalten beabsichtigen.
Diese Strategie ist durchaus verständlich angesichts des Tempos, mit dem sich die Welt verändert. Doch beim Versuch, auf diese Entwicklung zu reagieren, wird die regelbasierte Ordnung zu einem gefährlichen Konzept, insoweit es die internationalen Spielregeln infrage stellt und den ohnehin zerbrechlichen Konsens zerstört, der 1945 die Kodifizierung dieser Spielregeln ermöglicht hat.
Hinzu kommt, dass der Begriff ausgesprochen elastisch und formbar ist. Er beruht nur teilweise auf schriftlichen Dokumenten, wie Lieberherr betont: Diese Ordnung scheint zwar auf dem Fundament des Völkerrechts zu stehen, bezieht aber auch unverbindliche Normen, Standards und Prozeduren ein, die in irgendwelchen Verhandlungsrunden und Abkommen festgelegt wurden. Deshalb könne sie „theoretisch Regeln und Normen beinhalten, denen bestimmte Staaten nicht unbedingt zugestimmt haben“.
Hier wird erneut das Konfliktpotenzial offenbar. Ein Beispiel: Für die US-Regierung ist der Begriff „regelbasierte Ordnung“ wie selbstverständlich mit den Werten verknüpft, die während des Kalten Kriegs die sogenannte freie Welt definierten, also Marktwirtschaft, Demokratie und Menschenrechte.5 In dieser Rhetorik kommt den westlichen Werten ein so entscheidender Stellenwert zu, dass Staaten, die diese Werte nicht teilen, automatisch negativ darauf reagieren.
Das ist ein zentrales Problem mit einer derartigen Konstruktion: Sie führt zwangsläufig zu einer Spaltung auf einer Ebene, auf der das Völkerrecht einen gemeinsamen Raum schafft, indem es Prozeduren und Orientierungen etabliert, die für alle, ungeachtet ihres jeweiligen Wertesystems, gelten sollen.
Auf dieser Ebene gilt es also, Werte und Prinzipien streng auseinanderzuhalten. Die jeweiligen Wertsysteme sind durch unterschiedlichen Kulturen beeinflusst; Prinzipien dagegen werden zwischen Staaten vereinbart, um ihre Beziehungen untereinander zu regeln.
Deshalb sollte sich, so die französische Politikwissenschaftlerin Tara Varma, der internationale Dialog mehr auf Prinzipien und weniger auf Werte konzentrieren, damit ein ehrlicher und ernsthafter Dialog im Geist der UN-Charta zustande kommt.
Mit ihrer permanenten Berufung auf eine regelbasierte Ordnung sind die USA in der Lage, den Diskussionsrahmen und die Spielregeln ganz nach ihren jeweiligen Bedürfnissen vorzugeben. Das hat für sie offensichtlich mehrere Vorteile. Erstens lässt sich damit begründen, warum die US-Regierung in den 1990er Jahren die verbindlichen Normen für Gewaltanwendung in zwei Fällen verletzt hat. Sowohl die Intervention im Kosovo als auch die im Irak erfolgten nicht im Einklang mit der UN-Charta und wurden teils mit Lügen begründet, etwa über die Massenvernichtungswaffen des Irak. Doch beide waren aus Sicht Washingtons unter Berufung auf die rules-based order legitim.
Das verweist auf einen weiteren Vorteil des Konzepts: Es hilft, die Welt vergessen zu machen, dass Washington, was das Völkerrecht betrifft, keineswegs als Musterschüler dasteht. Zum Beispiel haben die USA nur vier der 19 internationalen Abkommen unterzeichnet, die sich auf den Schutz der Menschenrechte beziehen. Dagegen haben die meisten EU-Mitgliedstaaten mindestens 16 dieser Abkommen ratifiziert.6
Die USA sind nicht einmal dem UN-Seerechtsübereinkommen von 1982 beigetreten, auf das sie sich aber im Streit mit Peking um die Spielregeln im Chinesischen Meer berufen. Und obwohl Washington ständig die Menschenrechte beschwört, sind sie weder dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH)) beigetreten – was sie mit China und Russland gemeinsam haben – noch haben sie die Zusatzprotokolle ratifiziert, die in Ergänzung der Genfer Konventionen von 1977 Regeln für die Kriegsführung (ius in bello) festlegen.
Es sei wohl praktischer, konstatiert John Dugard, „zweifelhafte Interpretationen des Völkerrechts zu stützen, indem man sich auf eine vage regelbasierte Ordnung beruft, als sich auf die völkerrechtlichen Bestimmungen selbst zu beziehen“. Dugard verweist auf einen weiteren Vorteil, der im Hinblick auf den Gazakrieg eine neue Bedeutung erhält: Man kann einen Verbündeten in Schutz nehmen, der gegen das internationale Recht verstößt.7
China und Russland haben auf die Propagierung des Konzepts schnell reagiert. In einer gemeinsame Erklärung vom 4. Februar 2022 gelobten sie, „die von den Vereinten Nationen geförderte internationale Architektur und die auf dem Völkerrecht basierende Weltordnung zu schützen“. Aus Sicht Pekings ist die regelbasiert Ordnung, die nur von wenigen Staaten getragen werde, eine Erfindung des Westens und seiner Verbündeten.
Die Berufung Chinas auf die UN-Charta ist allerdings ziemlich unverfroren. Denn Peking interpretiert diese Charta entschieden konservativ, indem sie vor allem zwei ihrer Kernprinzipien betont: das Primat der staatlichen Souveränität und den Grundsatz der Nichteinmischung. Eine solche Sichtweise, die sich um Menschenrechte nicht weiter kümmert, findet logischerweise Anklang lediglich in solchen Ländern, die sich über Machtmissbrauch durch den Westens empören.
Die regelbasierte Ordnung kann man auch als eine Reaktion auf den schwindenden Einfluss des Westens sehen. Mit einem neuen Konzept will man wieder mehr Kontrolle über politischen Entwicklungen gewinnen: Dinge zu benennen ist eine Methode, sie zu kontrollieren.
Deshalb wird die Semantik so häufig zum Feld von heißen Debatten und Konkurrenz um Deutungshoheit. Die Russen zum Beispiel sprechen nie von einer „Annexion“ der Halbinsel Krim, sondern von deren „Anschluss“. Das neutralere Wort soll den Eindruck vermitteln, es gehe um einen freiwilligen Zusammenschluss.
Der Begriff regelbasierte Ordnung wiederum soll den USA helfen, ihre Rolle als globale Kontrollmacht abzusichern, die sie seit Jahrzehnten innehaben. Wie groß diese Macht noch ist, wird sich auch daran zeigen, wie groß und begeistert die Gefolgschaft ist, die den Begriff übernimmt. In dieser Hinsicht ist es also durchaus bezeichnend, dass dies bislang überwiegend westliche Länder sind.
„Die Fragmentierung der Welt ist weit über den Kampf der Großmächte hinaus gelangt“, diagnostiziert der französische Politikwissenschaftler Jean-Vincent Holeindre8 und spricht von einer „Kollision der Narrative“. Die aktuellen Polemiken, bei denen es um die Grundprinzipien des Multilateralismus geht, könnten die UNO an den Rand ihres Zusammenhalts bringen.
1 „United States-France Joint Statement“, 29. Oktober 2021.
6 Siehe die interaktive Karte der ratifizierten Verträge auf der Website des UN-Generalsekretärs.
Aus dem Französischen von Heike Maillard




