Wer hat Angst vor China?
Der Aufstieg der Volksrepublik zur Weltmacht ist nicht das Ergebnis einer großen Strategie
von Renaud Lambert
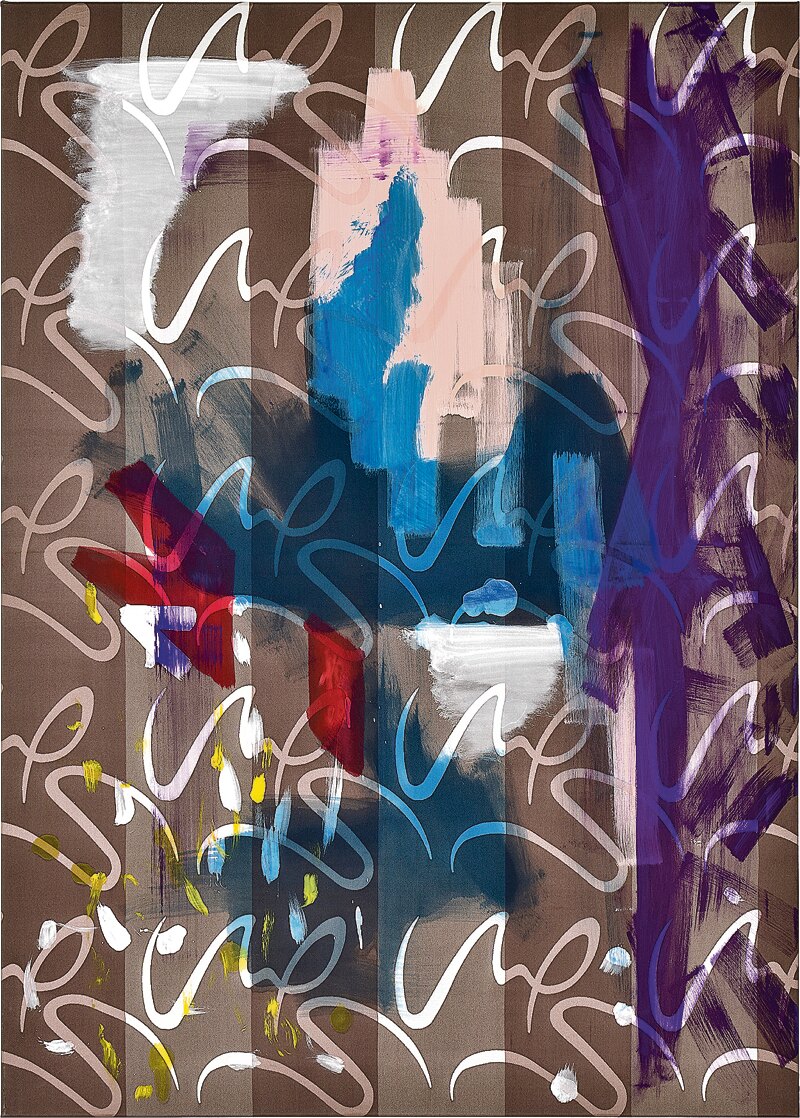
Wenn es um China geht, herrscht die Überzeugung vor, das Land versuche die „globale Ordnung“ umzustürzen und eine neue nach seinen Vorstellungen zu errichten. Die Regierung in Peking arbeite geduldig an der Umsetzung einer „Großen Strategie“ (Grand Strategy), um dieses Ziel zu erreichen.
Der Politikwissenschaftler David B. H. Denoon schreibt, es gebe einen chinesischen „Fahrplan zur Weltmacht“.1 Und Michael Pillsbury, Mitglied der konservativen Denkfabrik Heritage Foundation und Architekt der China-Politik von Ex-Präsident Donald Trump, gibt sich sogar überzeugt, dass solch eine geheime Strategie bereits 1949 bei der Gründung der Volksrepublik beschlossen und für einen Zeitraum von 100 Jahren angelegt worden sei.
Als besonders besorgniserregend gilt, dass ein einzelgängerischer Autokrat diese Strategie entworfen habe, sie zumindest steuere: Xi Jinping, den die französische Zeitung Les Échos den „roten König“ nennt, dessen „Ambitionen auf die globale Führung“ laut dem japanischen Magazin Nikkei Asia „immer deutlicher werden“ und der, so der US-Sender CNN, fest entschlossen sei, „die Welt neu zu gestalten“, insbesondere durch die Neue Seidenstraße.
Das ursprünglich als „One Belt, One Road“ bezeichnete und später in „Belt and Road Initiative“ (BRI) oder auch Neue Seidenstraße umbenannte Projekt wurde am 7. September 2013 von Präsident Xi ins Leben gerufen. Laut der chinesischen Regierung hat sie das Ziel, „die regionale Vernetzung zu stärken und gemeinsam eine bessere Zukunft zu schaffen“.2 Dies soll insbesondere durch Kredite für Infrastrukturinvestitionen geschehen, die nicht an politische Auflagen gebunden sind und deren Umfang auf 1 Billion US-Dollar geschätzt wird.
Nach Ansicht des Australian Strategic Policy Institute (Aspi) handelt es sich dabei um schöne Versprechungen, hinter denen sich eine dunkle Realität verbirgt: Die Initiative ziele darauf, Chinas Partner in eine Schuldenfalle zu locken, um eine chinesische „Sphäre der Hegemonie“ zu schaffen.3 Die scharfe Kritik aus dem Westen hat die Regierung in Peking kürzlich veranlasst, das Etikett „Neue Seidenstraße“ fallen zu lassen und die Zahl der offiziell damit verbundenen Projekte zu reduzieren. Die politische Stimmung in Washington sei inzwischen „so chinafeindlich geworden, dass jede ausgestreckte Hand gegenüber Peking der Schwäche verdächtigt wird“, schrieb die Financial Times.4
Es stimmt zweifellos, dass sich Peking bei seinen Massenparteitagen gerne als Zentrum der Macht inszeniert. Aber ist die Darstellung Chinas als hyperzentralisierter Einheitsstaat, in dem die Anweisungen von oben allen aufgezwungen werden, wirklich begründet? Betrachtet man die Transformation des Staats seit der Machtübernahme durch Deng Xiaoping in den späten 1970er Jahren, können daran durchaus Zweifel aufkommen.
Der damals vollzogene Bruch war die Folge einer Krise: Das maoistische Modell war gescheitert, der Lebensstandard stagnierte. Aber die schwache Entwicklung der chinesischen Wirtschaft und die Vertrauenskrise aufgrund der Kulturrevolution reicht als Erklärung nicht aus, warum das Land einen Prozess der Marktreformen einleitete. Die US-amerikanische Forscherin Susan L. Shirk vermutet eher ein „politisches Kalkül“.
Nach dem Tod von Mao Tse-tung 1976 habe sich China in einem „Erbfolgekrieg“ befunden, schreibt Shirk.5 „Deng Xiaoping nutzte die Wirtschaftskrise, um Hua Guofeng [den Vorsitzenden der Kommunistischen Partei Chinas und designierten Nachfolger Maos] zu diskreditieren und die Lenker der Industrie in der Bürokratie zu schwächen. Das Reformprogramm wurde zum Werkzeug, mit dem Deng den Wettstreit mit Hua um die Nachfolge Maos ausfocht.“
Gegen seine Widersacher, die für mehr Schwerindustrie und Planung plädierten, setzte Deng auf Dezentralisierung, er beschnitt also die Macht des Zentralstaats. Er übertrug immer mehr Machtbefugnisse an die Parteikader in den Provinzen. Die lokalen Behörden animierte er zu gewinnbringenden Experimenten in der Landwirtschaft, in der Industrie und im internationalen Handel. So schmiedete er durch seine Reformen eine modernisierungsfreundliche Koalition über das ganze Land.
Die Aufgaben der Zentralregierung wurden damit auf die makroökonomische Steuerung reduziert, so legte sie etwa weiterhin Zinssätze und Wechselkurse fest. Die Planwirtschaft existierte zwar weiter, allerdings im Wesentlichen auf lokaler Ebene und ohne eine echte Abstimmung mit den übergeordneten Stellen. Im ganzen Land entwickelte sich eine Art „ungezügelter interner Wettbewerb“, schreibt der Soziologe Hung Ho-fung, was zum „Aufbau redundanter Produktionskapazitäten und Infrastruktureinrichtungen führte“.6
So bemühten sich 20 der 30 chinesischen Provinzen im Jahr 1997 um den Aufbau einer eigenen Automobilindustrie. Das Land verfügte über 122 Autofabriken, von denen vier Fünftel nicht einmal 1000 Fahrzeuge im Jahr herstellten und nur sechs mehr als 50 000. Die Wirtschaftssysteme waren von Provinz zu Provinz unterschiedlich. Die Küstenregionen rollten dem ausländischen Kapital den roten Teppich aus, dessen Einfluss auf die Politik entsprechend zunahm. Die Provinzen im Landesinneren hingegen sorgten sich mehr um die einheimischen Unternehmen, die sie vor der Konkurrenz schützen wollten.
Die Dezentralisierung erstreckte sich auch auf die Bereiche Bildung, Gesundheit, Justiz und Steuern. Die Provinzen wurden zudem zur Einrichtung von Sonderwirtschaftszonen ermutigt und erhielten die Erlaubnis, ihre Wirtschaftsbeziehungen mit dem Ausland direkt zu managen. Sie gründeten eigene Büros für auswärtige Angelegenheiten und wurden zu wichtigen Akteuren in den diversen Gremien der internationalen Zusammenarbeit.
In ihrem Buch „Fractured China“7 , in dem sie die These vom monolithischen Einheitsstaat kritisieren, bezeichnen die Politikwissenschaftler Lee Jones und Shahar Hameiri das Handeln der Provinzregierungen als „Paradiplomatie“.7 Diese ging mitunter so weit, dass die Provinzen direkt Abkommen mit ausländischen Regierungen unterzeichnen. So gründete die Provinz Yunnan 1999 das Kooperationsforum Bangladesch-China-Indien-Birma, und die Provinz Guangxi folgte 2006 mit dem Pan-Beibu-Golf-Forum für wirtschaftliche Zusammenarbeit.
Die diplomatische Ausrichtung der Provinzen orientierte sich allein an ihren wirtschaftlichen Interessen. Da sie in der Hierarchie gleichrangig mit dem Außenministerium agierten, kümmerten sie sich wenig um dessen allgemeine Ziele. Während also vor 1979 die Zentralregierung den gesamten Außenhandel und die ausländischen Direktinvestitionen beaufsichtigte, wurde deren Kontrolle seit Anfang der 1990er Jahre weitgehend dezentralisiert.
Parallel zur Emanzipation der Provinzen fand im Rahmen von Dengs Reformen ein umfassender Privatisierungsprozess statt, der die Unternehmen aus der staatlichen Lenkung entließ. Es handelte sich zum einen um Privatisierungen im eigentlichen Sinn, zum anderen aber lediglich um die Übernahme von Staatsunternehmen durch die lokalen Behörden. Nachdem die Unternehmen auch von ihren Verpflichtungen zur lebenslangen Beschäftigung und zur sozialen Absicherung ihrer Angestellten befreit worden waren, blieb für sie nur noch eine einzige Aufgabe: Gewinne zu machen, um ihr Fortbestehen zu sichern.
Die größten Unternehmen, die teilweise aus der Umwandlung von spezialisierten Ministerien in Betriebe hervorgingen, behielten ihren Platz im Organigramm der Zentralmacht. Die anderen Betriebe nutzten die Protektion ihrer Heimatprovinzen, um voranzukommen – meist gegen die Konkurrenz im eigenen Land.
All dies ist weit entfernt vom Bild eines allmächtigen Xi Jinping, der als Solitär an der Spitze die geopolitische Strategie seines Landes steuert. In Wirklichkeit hält die chinesische Führung nach Jahrzehnten der Dezentralisierung, Fragmentierung und Internationalisierung das Ruder nicht mehr allein in der Hand. „Sie nutzt verschiedene Mechanismen, um die anderen Akteure des Einparteienstaats in die gewünschte Richtung zu lenken“, schreibt Lee Jones. Allerdings seien die Vorgaben vage genug, um Raum für Interpretationen und Verhandlungen, also für den Dialog mit den untergeordneten Ebenen zu lassen.
Diese nehmen Einfluss auf wichtige Direktiven, ergänzen sie und gelegentlich ignorieren sie sie auch. Auf diese Weise sind sie an der Gestaltung und der Umsetzung der Politik beteiligt und lassen ihre eigene Agenda und ihre speziellen Interessen einfließen. Manchmal entstehen die Direktiven aus Peking sogar auf Druck von unten, so wie im Fall der im Jahr 2000 verabschiedeten Strategie zur Expansion chinesischer Unternehmen ins Ausland („Go Out policy“), die eine schon seit den frühen 1990er Jahren geübte Praxis in offizielle Politik verwandelte.
Man könnte dem entgegenhalten, dass Xi 2013 vom Volkskongress gerade deshalb gewählt wurde, weil er die Macht wieder zu zentralisieren versprach. Damals waren viele führende Mitglieder der KPCh der Meinung, die Präsidentschaft von Hu Jintao (2003–2013) sei von Chaos und Korruption geprägt gewesen, und sahen darin die Ursache für die starke Zunahme der Ungleichheit und für die Schwäche Chinas. Sie wollten nun einen starken Mann, der die zentrifugalen Tendenzen im Lande umkehren würde.
Tatsächlich hat der neue Staatschef dann das vollzogen, was der Ökonom Branko Milanović als „Linkswende“ bezeichnet: „Ausweitung der Rolle von Staat und Partei, Einschränkung der Macht der Kapitalisten und Beibehaltung eines zufriedenstellenden Wachstumsniveaus, ohne die Gesellschaft zu destabilisieren“.8
Das bedeutet jedoch nicht, dass Xi den Einparteienstaat mit seinen rund 40 Millionen Kadern, davon 500 000 in Führungspositionen, völlig umgebaut hätte. 2023 liefen immer noch 85 Prozent der chinesischen Staatsausgaben über die Lokalregierungen, fast dreimal so viel wie im Durchschnitt der OECD-Länder. Da Xi die Bürokratie nicht entmachten konnte, blieb ihm nur, sie sich nutzbar zu machen. Jones und Hameiri kommen zu dem Schluss, dass der chinesische Präsident „die Spielregeln nicht geändert hat“. Er hat einfach besser gespielt.
Vor diesem Hintergrund muss die Initiative Neue Seidenstraße anders interpretiert werden, als sie von den meisten westlichen Denkfabriken dargestellt wird. Sie bündelt Dutzende bereits zuvor bestehender Initiativen. In Kirgistan etwa wurden acht der dortigen Projekte schon unterzeichnet, bevor die Initiative offiziell vorgestellt wurde.9
Die Idee, das Ganze unter einem gemeinsamen, nicht näher definierten Etikett zusammenzufassen, entstand erst im Nachhinein. Es wurde jedoch nur zu gern von Ministerien, Provinzen und Unternehmen aufgegriffen, um politische Unterstützung und Projektmittel zu erhalten. Wegen der Überinvestitionen im eigenen Land orientierten sich die chinesischen Wirtschaftsakteure in dieser Zeit ohnehin immer stärker ins Ausland – was auch dem im Aufschwung befindlichen Exportsektor zugutekam.
Auf die globale Finanzkrise von 2008 reagierte China mit einem gigantischen Investitionsprogramm. „Viele Lokalregierungen, die mit billigem Geld überschwemmt wurden, verwendeten einen Großteil der neuen Kredite für den Bau überflüssiger Infrastruktur und von Produktionsanlagen, die zwar die regionale Wirtschaftsleistung steigerten, aber keine Aussicht auf langfristige Rentabilität boten“, analysiert der Soziologe Hung.
So erklären sich auch die folgenden schwindelerregenden Zahlen: China verbrauchte zwischen 2011 und 2013 mehr Zement als die USA im gesamten 20. Jahrhundert.10 Überall entstanden riesige Neubausiedlungen, die zum Teil bis heute leer stehen. Es war die Keimzelle der aktuellen Krise des Immobiliensektors.
Die durchschnittliche Profitrate von über 20 Prozent im Jahr 2010 war bis 2018 auf 12,4 Prozent gesunken.11 Allerorten kam es zu Überkapazitäten und Überinvestitionen. Die chinesischen Wirtschaftsakteure suchten daher nach einer, „räumlichen Lösung“, wie der Geograf David Harvey es nennt: dem Export ihrer überschüssigen Kapazitäten ins Ausland. In einem kapitalistischen System ist das die klassische Lösung für derartige Probleme.
Die Neue Seidenstraße ist also keineswegs die Umsetzung einer strategischen Vision in die Praxis. Sie ist vielmehr das Ergebnis einer Aneinanderreihung von Projekten, deren wesentliche Motivation nicht diplomatischer, sondern wirtschaftlicher Natur war. Es ist der gleiche Prozess, der schon seit Beginn der 1990er Jahre zu beobachten war: Die wirtschaftlichen Akteure stellen die Weichen für die nationale Politik.
„Die seit Jahren aufgebauten Überkapazitäten in der Industrie sind in letzter Zeit zu einem großen Problem geworden“, warnte schon 2014 der damalige stellvertretende Außenminister He Yafei. „Wenn nichts unternommen wird, könnte dies zum Zusammenbruch ganzer Industriezweige führen.“12 Entscheidend sei, so He damals, diese Herausforderung in eine Chance zu verwandeln, „indem wir diese Überkapazitäten auf der Grundlage unserer Entwicklungsstrategie im Ausland und unserer Außenpolitik ‚exportieren‘.“ Nur ein Jahr später wurde das zunächst noch recht nebulöse Projekt der Neuen Seidenstraße erstmals offiziell vorgestellt.
Natürlich wirken sich grenzüberschreitende Investitionen dieser Größenordnung auf die Beziehungen Chinas zu seinen Partnern aus. Dass die Seidenstraße-Projekte aus einem wirtschaftlichen Bedürfnis heraus entstanden, bedeutet schließlich nicht, dass sie keine diplomatischen Auswirkungen haben. Und für die chinesische Regierung sind sie überaus willkommen.
In Bezug auf die Empfängerländer in Südostasien schreibt der Economist, diese hätten „zunehmend Vertrauen“ in die chinesischen Investitionen.13 Und man sei dort weit davon entfernt, Chinas Initiative abzulehnen, wie einige im Westen gehofft hätten. Denn die Belt-and-Road-Projekte spiegelten eher die Prioritäten der lokalen Eliten als die Chinas wider. „Die Vorstellung, China ziele mit seiner Diplomatie darauf ab, seine Partner in eine Schuldenfalle zu locken, ist übertrieben.“
Im Gegenteil: Insgesamt könnten die Seidenstraßen-Projekte „grundlegende und nachhaltige“ positive Effekte haben, schreibt der Economist. Für die chinesische Diplomatie sind sie natürlich von großem Nutzen, was nichts daran ändert, wie und aus welchen strategischen Motiven die Initiative ursprünglich entstanden ist.
Die Neue Seidenstraße als räumliche Lösung für ein Überakkumulationsproblem, das direkt mit Chinas Integration in die Weltwirtschaft zusammenhängt, ist noch kein Indiz für Chinas Willen, die Weltordnung umzustürzen. Eher im Gegenteil: Das Land unterwirft sich ihren ökonomischen Regeln. „Anstatt eine neue Weltordnung zu schaffen, ist China allenfalls eine neue Macht in der alten Ordnung“, stellt Hung fest.
Warum also sind die USA so beunruhigt? Vielleicht liegt es daran, dass diese Ordnung nicht nur durch eine bestimmte Architektur, sondern auch durch eine Hierarchie gekennzeichnet ist. Für die Architektur stellt China eine weniger große Bedrohung dar, als die US-Regierung zu befürchten scheint. Umso mehr stellt es die Hierarchie infrage, und das dürfte für Washington entscheidend sein.
Die USA hatten lange vom Aufstieg Chinas profitiert, denn er verschaffte US-Unternehmen satte Gewinne und half bei der Finanzierung der Defizite, indem Peking in großem Umfang US-Staatsanleihen kaufte. Inzwischen aber wächst in den USA die Befürchtung, dass China die USA im Spiel des freien Handels übertrumpft. Es ist ein Spiel, dessen Regeln die USA gemacht haben, mit dem Ziel, ihre Vormachtstellung zu sichern.
Dazu gehörte beispielsweise die Forderung nach der Öffnung der Waren- und Finanzmärkte. Doch diese von Teilen der Wirtschaftswissenschaft, von Denkfabriken und auch vielen Medien als „ökonomische Gesetze“ propagierten Regeln garantieren nicht länger die Vormachtstellung der USA, weshalb sie überarbeitet werden müssen. Und zwar im Sinne eines höheren Interesses, nämlich der nationalen Sicherheit der USA. Anders ausgedrückt: sie sollen so umgestaltet werden, dass sie den Vereinigten Staaten den Platz an der Spitze der Welthierarchie weiterhin sichern.
Im April vergangenen Jahres deutete der Nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan eine derartige Wende in der US-Wirtschaftspolitik an.14 Die Zeit sei reif für einen „neuen Washington-Konsens“, verkündete er in Anspielung auf den neoliberalen Maßnahmenkatalog, der nach dem Zusammenbruch des kommunistischen Blocks 1990 die Rezepte des siegreichen Kapitalismus international hatte durchsetzen sollen.

Billiges Geld im Überfluss
Damals zielte der sogenannte Konsens auch darauf ab, immer mehr Länder für die von den USA aufgebaute internationale Ordnung zu gewinnen. Aus dieser Logik heraus setzte sich der damalige Präsident Bill Clinton für die Aufnahme Chinas in die Welthandelsorganisation (WTO) ein. „Dies ist unsere größte Chance, seit Präsident Nixon in den 1970er Jahren das Land besuchte, einen positiven Wandel in China herbeizuführen“, erklärte Clinton am 9. März 2000 vor dem US-Kongress. „Durch den Beitritt zur WTO akzeptiert China nicht nur, mehr von unseren Produkten zu importieren; es akzeptiert auch, einen der Werte zu importieren, die unserer Demokratie am meisten am Herzen liegen: wirtschaftliche Freiheit.“
Nun ist China dank dieser wirtschaftlichen Freiheit schon vor fast zehn Jahren zur größten Wirtschaftsmacht der Welt aufgestiegen, jedenfalls wenn man das kaufkraftbereinigte Bruttoinlandsprodukt als Grundlage nimmt. Und laut CIA bietet ebendieses „die beste Darstellung von Wirtschaft und Wohlstand in verschiedenen Ländern“.15 Es war der freie Handel, der China die Chance bot, Technologien zu erwerben und dann selbst weiterzuentwickeln, die nun den Vorsprung der USA bedrohen.
„Uns ist bewusst geworden, dass unsere jahrzehntelangen Bemühungen, die Volksrepublik China zu formen oder umzugestalten, nicht erfolgreich waren“, musste Sullivan am 30. Januar 2024 vor dem Council on Foreign Relations einräumen.16 Umso dringlicher sei es nun, „unsere Kerntechnologien zu schützen“, selbst wenn die Regierung dafür auf protektionistische Maßnahmen zurückzugreifen müsse.
Während Clinton im Jahr 2000 „die Annahme, dass man zwischen wirtschaftlicher und nationaler Sicherheit wählen müsse“, für falsch hielt, verkündet Sullivan nun das genaue Gegenteil: „Die Welt braucht ein internationales Wirtschaftssystem, das unserer nationalen Sicherheit gerecht wird.“ Mit anderen Worten, die Architektur der internationalen Ordnung muss verändert werden, damit ihre Hierarchie sich nicht ändert.
Bekanntlich folgen nicht allen politischen Reden auch Taten. Sullivans Äußerungen bestätigen jedoch eine Trendwende, die bereits seit der Wahl von Donald Trump zum Präsidenten im Jahr 2016 im Gange ist. Nachdem dieser 2017 die Transpazifische Partnerschaft (TPP) eingemottet und drei Jahre später das Nordamerikanische Freihandelsabkommen (Nafta) neu verhandelt hatte, setzte sein Nachfolger Joe Biden die protektionistische Wende vor allem im Bereich der Spitzentechnologie fort.
Beispiele dafür sind der „Chips and Science Act“ vom 9. August 2022, der die US-Halbleiterindustrie mit rund 280 Milliarden US-Dollar fördert; der „Inflation Reduction Act“ vom 16. August 2022, der rund 350 Milliarden US-Dollar für die Energiewende vorsieht und dabei die antragstellenden Unternehmen dazu verpflichtet, den Großteil ihrer Produktion in den USA anzusiedeln; und das „Outbound Investment Program“ vom 8. August 2023, ein Erlass des Präsidenten, der US-Investitionen in China (inklusive Hongkong und Macao) in Sektoren verbietet, die mit Militär, Überwachung und Geheimdienstaktivitäten zu tun haben.
Das Narrativ von Chinas umfassender Strategie zur Erlangung der Weltherrschaft scheint alles in allem weniger eine Beschreibung der Realität zu liefern, als vielmehr Ausdruck eines Wunsches zu sein, diese Realität nach eigenen Wünschen umzugestalten. Wenn man einem möglicherweise künftigen Gegner Drohgebärden unterstellt, hat man einen Grund, selbst Drohszenarien aufzubauen.
Graham Allison, ein von Präsident Biden hoch geschätztes Mitglied des Council on Foreign Relations, hat genau dies in einem 2017 erschienenen Buch getan: „Das US-Militär könnte heimlich separatistische Aufständische ausbilden und unterstützen“, schreibt Allison darin. „Es gibt bereits kleine Bruchstellen im chinesischen Staat. Eine versteckte, aber konzentrierte Anstrengung (…) könnte mit der Zeit das Regime kompromittieren und Unabhängigkeitsbewegungen in Taiwan, Xinjiang, Tibet und Hongkong fördern. Das würde für eine Spaltung Chinas sorgen, und Peking würde sich festfahren bei seinen Anstrengungen, die innere Stabilität aufrechtzuerhalten.“
Diese Strategie jedenfalls existiert tatsächlich – zumindest auf dem Papier.
2 „China unveils action plan on Belt and Road Initiative“, China Daily, 28. März 2015.
3 Brahma Chellaney, „China’s debt-trap diplomacy“, The Strategist, 24. Januar 2017.
4 Edward Luce, „China is right about US containment“, Financial Times, 9. März 2023.
8 Branko Milanović, „Xi Jinping is not Mao reborn“, 13. Dezember 2023, unherd.com.
12 Zitiert nach Hidayatullah Kha und anderen, siehe Anmerkung 9.
13 „South-East Asia learns how to deal with China“, The Economist, 11. Januar 2024.
Aus dem Französischen von Nicola Liebert




