Paralleljustiz
Wenn Konzerne gegen Staaten klagen
von Vincent Arpoulet und Meriem Laribi
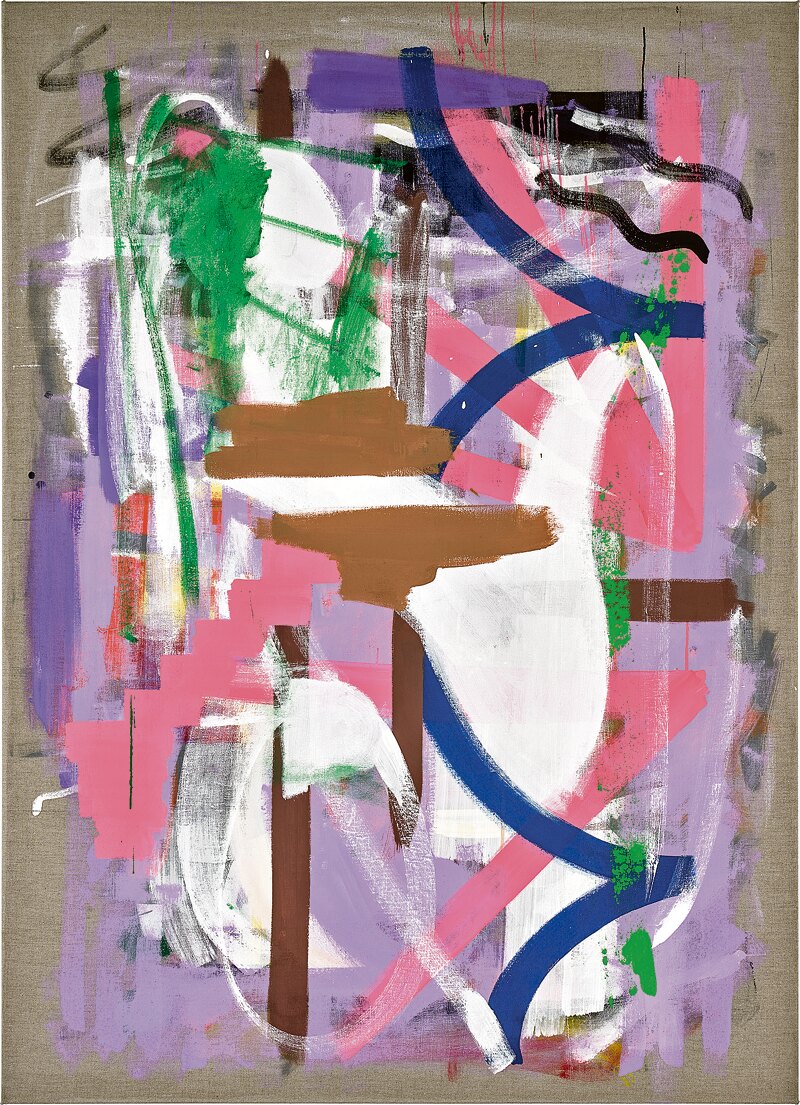
Ab Januar 2008, fünf Monate nach Ausbruch der Finanzmarktkrise, begann der Ölpreis explosionsartig zu steigen. Damals wollte Ecuadors Präsident Rafael Correa, erst seit einem Jahr im Amt, den staatlichen Anteil an den Einnahmen aus dem Erdölexport von 50 Prozent auf 99 Prozent erhöhen. Das Parlament zwang ihn, sich mit 80 Prozent zu begnügen.
Dem französischen Ölkonzern Perenco war das immer noch zu viel. Das in Ecuador tätige Unternehmen beschuldigte die Regierung in Quito der „indirekten Enteignung“ und rief das Internationale Zentrum zur Beilegung von Investitionsstreitigkeiten (ICSID) an, eine Institution der Weltbankgruppe, die sich als Instanz für Investitionsschiedsverfahren einen Namen gemacht hat.1
Die Muttergesellschaft von Perenco ist auf den Bahamas, einer Steueroase, registriert, doch der Perenco-Firmensitz liegt in der französischen Hauptstadt. Deshalb berief sich der Konzern auf das von den Regierungen in Paris und Quito 1994 unterzeichnete bilaterale Investitionsschutzabkommen (Bilateral Investment Treaty, BIT). Perenco forderte die Zahlung von 1,42 Milliarden US-Dollar; was 2,27 Prozent des ecuadorianischen Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 2008 entsprach.
Präsident Correa protestierte gegen dieses Vorgehen und antwortete mit dem Austritt Ecuadors aus der ICSID-Konvention. Er brachte sogar eine Verfassungsänderung durch, wonach es dem Staat Ecuador verboten ist, „seine souveräne Rechtsprechung an internationale Schiedsgerichtsbarkeiten abzutreten“.2 Außerdem leitete er eine Überprüfung der von Ecuador ratifizierten Investitionsschutzabkommen ein, von denen einige dann gekündigt wurden, unter anderem 2017 das Abkommen zwischen Quito und Paris.
Die BIT-Abkommen enthalten üblicherweise allerdings eine „sunset clause“. Damit bleibt der Mechanismus für die Investor-Staat-Streitbeilegung (investor-state dispute settlement, ISDS) noch bis zu 20 Jahre nach Kündigung wirksam. Im Fall des französisch-ecuadoranischen Abkommens waren es 15 Jahre. Als 2021 der konservative Präsident Guillermo Lasso an die Macht kam, trat Ecuador erneut der ICSID-Konvention bei. Noch im selben Jahr verurteilte ein Schiedsgericht das Land zur Zahlung von 374 Millionen US-Dollar an Perenco, die Präsident Lasso unverzüglich anwies.
Das von Perenco gegen Ecuador angestrengte Verfahren ist nur eines von mehreren hundert, bei denen Staaten erleben, wie ihre Souveränität unter die Räder privater Interessen gerät.
2009 verklagte der schwedische Energieversorger Vattenfall die Bundesrepublik Deutschland auf Schadenersatz in Höhe von 1,4 Milliarden Dollar, weil seine Investitionen „unrentabel“ geworden seien. Hintergrund waren verschärfte Umweltauflagen der Stadt Hamburg für die Betriebsgenehmigung eines Kohlekraftwerks.
2022 forderte die US-Firma Prospera 10,8 Milliarden Dollar Entschädigung von der Republik Honduras. Die
honduranische Regierung hatte dem Unternehmen ursprünglich zugesagt, auf der Insel Roatán einen Stadtstaat mit eigener Gesetzgebung zu gründen, dieses Projekt dann aber auf Eis gelegt. Die 10,8 Milliarden US-Dollar entsprachen zwei Dritteln des Staatsbudgets.
2015 verurteilte ein Schiedsgericht Argentinien zur Zahlung von mehr als 400 Millionen Dollar, nachdem mehrere Privatunternehmen, darunter Suez und Vivendi, Klage eingereicht hatten, weil die argentinische Regierung nach der Finanzkrise 2001 die Wasser- und Strompreise eingefroren hatte.
Die Zahl der beim ICSID eingegangenen Klagen hat sich in den letzten zehn Jahren verdoppelt; insgesamt sind es 998 seit Gründung der Institution im Jahr 1966.3 Nach Angaben der Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung (Unctad) wurden bis Ende 2022 gegen 132 Länder insgesamt 1257 ISDS-Verfahren angestrengt. Doch weil manche Schlichtungen vertraulich bleiben, liegt „die tatsächliche Zahl der Streitfälle wahrscheinlich höher“.4
Nach Ende des Zweiten Weltkriegs betrachteten die gerade gegründeten Vereinten Nationen die Entwicklung der internationalen Handelsbeziehungen als Fundament für einen dauerhaften Friedens, doch nur unter der Voraussetzung fester Regeln. 1966 wurde die Kommission der Vereinten Nationen für internationales Handelsrecht (Uncitral) gegründet. Das „lex mercatoria“ – die Gesamtheit der gewohnheitsrechtlichen Handelsnormen, die sich seit dem Mittelalter entwickelt hatten, wurde durch das moderne internationale Handelsrecht abgelöst.
Dieser neue rechtliche Rahmen stärkte den Einfluss der Privatwirtschaft und führte dazu, dass immer mehr zwischenstaatliche Freihandelsabkommen unterzeichnet wurden. Heute sehen 93 Prozent dieser Abkommen ISDS-Mechanismen5 , also die Anrufung von Schiedsgerichten für die Klärung von Rechtsstreitigkeiten, vor. Die Fürsprecher dieser privaten, von jeder staatlichen Einflussnahme unabhängigen Gerichtsbarkeit argumentierten, damit sei eine Unparteilichkeit gewährleistet, die staatliche Gerichte nicht garantieren könnten.
Die ersten BIT-Abkommen fallen noch in das Jahrzehnt der Entkolonialisierung. Sie zielten vor allem darauf, die Investoren aus den westlichen Ländern zu schützen, dienten also auch dem Fortbestand der kolonialen Verhältnisse. Somit konnten die multinationalen Konzerne die Länder des Globalen Südens weiter ausplündern.
In den 1990er Jahren, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, nahm die Zahl dieser Abkommen im Gefolge des neoliberalen Siegeszugs weiter zu. Es war der Beginn eines Kolonialismus neuen Typs: In den meisten Ländern der Welt übernahmen die international agierenden Unternehmen selbst die Macht.
Üblicherweise enthalten die BITs eine Reihe mehr oder weniger präzise formulierter Klauseln, die alle möglichen Interpretationen zulassen. Das gilt etwa für das „Verbot direkter oder indirekter Enteignung“ oder die „gerechte und billige Behandlung“, die dafür sorgen sollen, dass nationale Gesetze den internationalen Investitionsschutz nicht beeinträchtigen.
Es geht also nicht nur darum, den Handlungsspielraum des Globalen Südens gegenüber dem Globalen Norden einzuschränken. Das Prinzip der staatlichen Souveränität selbst wird unterlaufen.
In diesem Streitschlichtungssystem klagen immer nur die ausländischen Investoren gegen Staaten, das Gegenteil ist nicht vorgesehen. Alle Prozesse spielen sich hinter verschlossenen Türen ab und ziehen sich teils über Jahre hin. Und da sie meist zugunsten der Kläger ausgehen, trägt die Verfahrenskosten in der Regel der Verlierer, also der beklagte Staat.
Dabei entsprechen die von den multinationalen Konzernen geforderten Unsummen oft keineswegs den anfänglichen Investitionen. Ein Beispiel dafür ist der seit 2006 andauernde Streitfall zwischen dem kuwaitischen Multimilliardär Nasser Al-Kharafi und dem Staat Libyen. Im Jahr 2012 verurteilte ein Schiedsgericht das nordafrikanische Land zur Zahlung von knapp 1 Milliarde Dollar. Al-Kharafi hatte jedoch nur 5 Millionen Dollar in ein Tourismusprojekt investiert, das nie umgesetzt wurde. Ein schöner Ertrag, deklariert als Entschädigung für hypothetische „entgangene Gewinne“.
Da Tripolis die Zahlung verweigerte, versuchte der Al-Kharafi-Konzern libysche Vermögenswerte konfiszieren zu lassen: Geldanlagen des libyschen Staatsfonds bei der französischen Bank Société Générale, das Gebäude der Fnac-Handelskette im Pariser Stadtteil Les Ternes oder das in Perpignan geparkte Flugzeug des libyschen Präsidenten. Bisher hatte der Investor keinen Erfolg, hauptsächlich, weil die meisten Vermögenswerte Libyens im Ausland seit 2011 eingefroren und weil Staatsfonds in Frankreich geschützt sind.7
Der Fall zeigt aber, dass sich ein Staat beträchtlichem internationalen Druck aussetzt, wenn er versucht, sich dem System der internationalen Schiedsgerichte zu verweigern. Die Investoren wissen genau, welche Gewinnaussichten das System bietet – entsprechend groß ist der Anreiz, ein Schiedsverfahren einzuleiten.
Auch für die Mitglieder der Schiedsgerichte, die die Streitfälle schlichten sollen, sind die Verfahren ein einträgliches Geschäft. Beim ICSID können die Schiedsgerichte aus einer Einzelrichterin oder einem Einzelrichter bestehen, sofern beide Parteien einwilligen. Oder sie setzen sich aus drei Schiedspersonen zusammen, von denen der beklagte Staat und das klagende Unternehmen jeweils eine Person benennen. Die dritte Schiedsperson, die den Vorsitz führt, wird von den beiden anderen Schiedspersonen gewählt.
Theoretisch wird von den Schiedspersonen keine bestimmte Qualifikation erwartet, aber das ICSID betont, dass sie Experten oder Expertinnen sein müssen, „deren Kompetenz im Bereich Justiz, Handel, Industrie oder Finanzen anerkannt“ ist.8 Und so sind die meisten Schiedspersonen ehemalige Richterinnen, Geschäftsanwälte, die ihre Karriere mit Schiedsgerichtsfällen gemacht haben, oder Unternehmer sind. Sie müssen keine Experten des internationalen Rechts sein und sie müssen auch nicht die Verfassung oder die Gesetze des Landes beachten, in dem die Investition getätigt wurde.

Befangene Schlichterin
Bei dieser Paralleljustiz liegt das Schicksal der Staaten de facto in den Händen von Personen, die finanzielle Interessen verfolgen. Ihre Vergütung, deren Höhe völlig im Dunkeln bleibt, hängt von Art und Anzahl der Verfahren ab. Nach Insider-Informationen verdienen sie pro Tag mehrere tausend Dollar. Auf einer Website, die auf die Analyse von ISDS spezialisiert ist, wird man belehrt: „Die Schiedspersonen verfügen über keine staatliche Legitimität und sind der Öffentlichkeit keine Rechenschaft schuldig. Ihre Entscheidungen […] können nicht angefochten werden.“9
Die Schiedspersonen befinden sich häufig in einem Interessenkonflikt. Das zeigt etwa der Fall von Gabrielle Kaufmann-Kohler, einer Schweizer Anwältin, die als Schlichterin im Streit zwischen Vivendi und Suez und dem argentinischen Staat fungierte. Im laufenden Verfahren wurde die Anwältin 2016 in den Verwaltungsrat der Schweizer Bank UBS berufen, die ein wichtiger Anteilseigner beider Konzerne ist. Sie informierte das Schiedsgericht aber nicht über ihren neuen Posten.
Argentinien versuchte zwar, ihren zugunsten von Vivendi und Suez ergangenen Schiedsspruch annullieren zu lassen, und wies verschiedene Instanzen auf den Interessenkonflikt hin, jedoch ohne Erfolg. Artikel 58 der ICSID-Konvention bestimmt, dass über einen Antrag auf Ablehnung einer Schiedsperson nicht etwa eine unabhängige dritte Instanz entscheidet, sondern die beiden anderen Mitglieder des Schiedsgerichts – und die kommen meist aus dem gleichen Umfeld wie die umstrittene Person.
Zum selben Umfeld gehören ein Teil des politischen Personals, das eigentlich die staatlichen Interessen vertreten sollte. So hat der ecuadorianische Außenminister Édgar Terán, der 1986 den Beitritt zum ICSID vollzogen hat, 16 Jahre später den Auftrag des IBM-Konzerns angenommen, mit seiner Anwaltskanzlei Terán & Terán die Interessen von IBM gegenüber seinem eigenen Land vor einem ICSID-Schiedsgericht zu vertreten.10
Und als Ecuador 2021 im Schiedsverfahren gegen Perenco unterlag, hieß Frankreichs Industrieministerin Agnès Pannier-Runacher, deren Vater Jean-Michel Runacher jahrzehntelang eine leitende Stellung bei Perenco bekleidet hatte. Danach war sie bis Januar 2024 Ministerin für die Energiewende. Doch nachdem das Investigativportal Disclose über mögliche Interessenkonflikte berichtet hatte11 , unterzeichnete Präsident Macron im November 2022 einen Erlass, der es Pannier-Runacher verbietet, sich um Angelegenheiten zu kümmern, die Perenco betreffen.
Nach Angaben der Unctad endeten 38 Prozent der Streitangelegenheiten im Zeitraum von 1987 bis 2021 nicht mit einer Verurteilung der beklagten Staaten. In 47 Prozent der Fälle ging das Verfahren zugunsten der Unternehmen aus, sei es, weil die Schiedsgerichte die Staaten im Sinne der Anklage verurteilten (28 Prozent), sei es, weil die Verfahren „beigelegt“ wurden, also ein Vergleich erzielt wurde (19 Prozent).12
Allerdings bringt die Androhung eines Schiedsverfahrens die Staaten häufig dazu, ihre legitimen Interessen nicht voll geltend zu machen oder auch vorweg Bußgelder zu zahlen, um eine eventuell höhere Strafe durch einen Schiedsspruch zu vermeiden. So musste im Fall Vattenfall gegen Deutschland die Stadt Hamburg im Zuge eines Vergleichs bestimmte wasserrechtliche Auflagen wieder zurücknehmen.
Das internationale Handelsrecht, das eigentlich die zwischenstaatlichen Beziehungen nach dem Zweiten Weltkrieg befrieden sollte, entwickelt sich immer stärker zum Instrument einer Dumping-Justiz zugunsten privater Unternehmen, die sich noch nie durch ihr Engagement in Sachen Umwelt, Gesundheit oder soziale Gerechtigkeit hervorgetan haben.
„All dies gibt den Unternehmen die nötigen Instrumente in die Hand, mit denen sie die staatliche Politik bekämpfen oder sogar blockieren können“, befindet der britische Journalist Matt Kennard.13 Es reiche schon aus, dass die Konzerne mit einem Schiedsverfahren drohen. „Für die Regierungen ist das mittlerweile ein Dauerproblem, das ihre Bereitschaft lähmt, politische Programme zugunsten der breiten Bevölkerung zu entwickeln.“
Viele Länder fragen sich, ob es sinnvoll ist, bei einem solchen System überhaupt mitzumachen. Andere haben bewiesen, dass sie darauf verzichten können. Brasilien hat nie ein BIT ratifiziert und gehört in Lateinamerika zu den Staaten mit der am besten entwickelten Industriestruktur. Auf Betreiben der Arbeiterpartei (PT), die von 2002 bis 2016 an der Regierung war, hat das Land das ISDS-System immer abgelehnt – und ist ihm bis heute nicht beigetreten.
Und dennoch stand Brasilien im ersten Halbjahr 2023 auf Platz 2 im weltweiten Ranking der Staaten mit den höchsten ausländischen Direktinvestitionen.14 Ein Staat kann sich also weigern, die Rolle des gefügigen Opfers zu übernehmen.
2 Verfassunggebende Versammlung, Verfassung der Republik Ecuador, 28. September 2008.
4 „Total number of known investment treaty cases rises to 1257“, Unctad, 19. April 2023.
8 „ICSID Convention, Regulations and Rules“, ICDS, Washington, April 2006.
9 Siehe, „The basics“, ISDS Platform, isds.bilaterals.org.
14 „FDI in Figures“, OECD, Oktober 2023.
Aus dem Französischen von Heike Maillard
Vincent Arpoulet ist Doktorand im Fach Wirtschaftswissenschaften. Meriem Laribi ist Journalistin.




