Die Geldverteiler
Bericht aus dem Innern des IWF
von Renaud Lambert
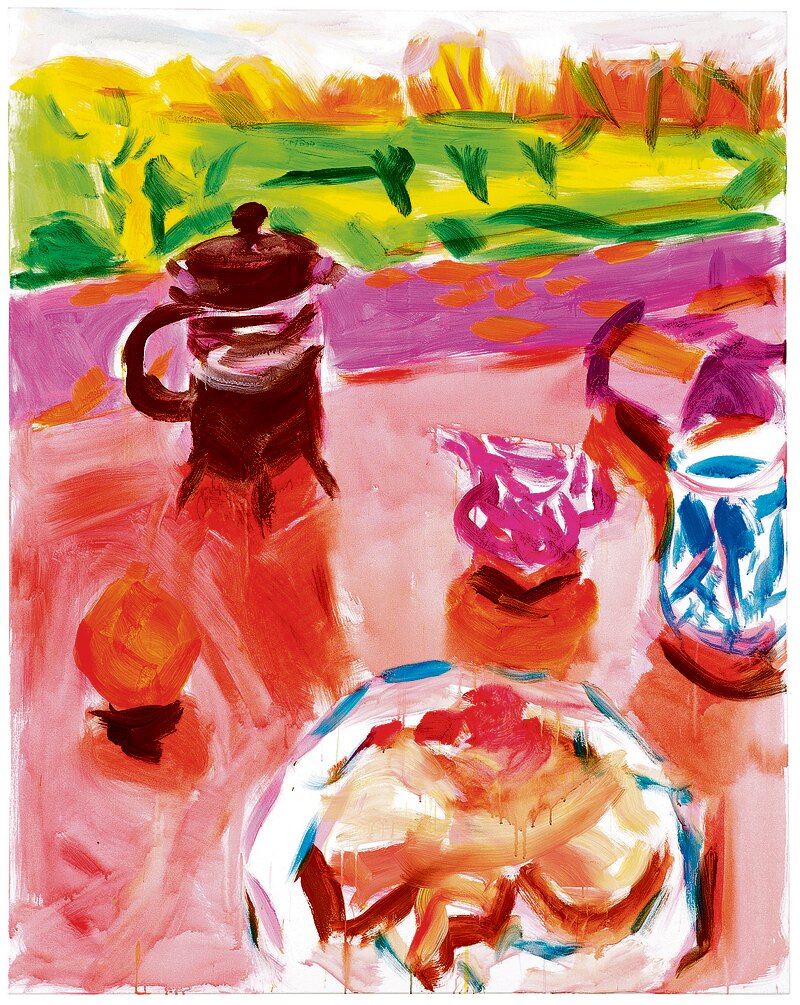
Die Fahrstuhltür öffnet sich. Zwei junge Frauen, die sich in einer slawischen Sprache unterhalten, verlassen den Lift. Die Badges an ihren Blazern weisen sie als bulgarische Volkswirtinnen aus. Die palästinensische Kommunikationsbeauftragte stellt uns dem Historiker der Organisation vor. Der indische Volkswirt führt uns nach dem Interview zur Leiterin der Strategieabteilung, einer türkischen Volkswirtin.
Anschließend treffen wir noch einen Holländer, einen Franzosen und einen Japaner, der uns bittet, ihn vor dem Logo der Organisation zu fotografieren. Auch diese drei sind Volkswirte.1
Zum Hauptquartier des Internationalen Währungsfonds (IWF) im Zentrum Washingtons sind wir zu Fuß gegangen. Über unseren Köpfen dröhnte ein riesiger Hubschrauber. Die Passanten um uns herum schienen vom Lärm der Rotoren völlig unbeeindruckt. Offenbar war diese Art von Spektakel für sie ganz normal.
Nachdem der Helikopter die Rasenflächen des Lincoln Memorial überflogen hatte, landete er auf dem Grün vor dem Weißen Haus. Da mussten wir noch gut einen Kilometer schaffen, vorbei am Treasury Department, dem Finanzministerium, der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS), der US-Notenbank, dem Außenministerium, der Weltbank und dem Museum für die Opfer des Kommunismus. Ein imposantes Quartier der Macht, und mittendrin unser Ziel: ein massives Gebäude, dessen Architektur an den Brutalismus erinnert, der offenbar den Genius Loci verkörpert.
Der IWF wurde kurz nach dem Zweiten Weltkrieg gleichzeitig mit der Weltbank gegründet. Beide Institutionen sollten verhindern, dass die internationalen ökonomischen Ungleichgewichte zu neuen Konflikten führen. Dabei sollte der IWF zum einen die Währungspolitik der Länder im Zuge des Wiederaufbaus koordinieren, zum anderen Staaten, denen es kurzfristig an Devisen mangelt, mit Mitteln aus einer gemeinsamen, von allen Mitgliedern alimentierten Kasse unter die Arme greifen.
Doch im Lauf der Zeit entwickelten sich der IWF und die Weltbank zur globalen Bastion des orthodoxen Neoliberalismus. Der Währungsfonds begann von den geförderten Ländern als Gegenleistung umfassende Reformen zu fordern, insbesondere Privatisierungen, Deregulierungen und Sparprogramme. Die davon betroffenen Menschen standen häufig vor der Frage: Werden wir morgen noch genug zu essen haben? Können wir uns einen Arzt leisten? Was wird aus den Schulen für unsere Kinder? Der neoliberal gewendete IWF wurde zu einer der umstrittensten Institutionen der Welt.
Das dürfte auch der Grund sein, warum die Organisation mit Journalist:innen auf ganz besondere Weise umgeht. Denen wird zwar ständig versichert, dass man größten Wert auf „Transparenz“ und „Offenheit“ lege. Dabei wird aber stets klargestellt, dass alle Gespräche „off the record“ geführt werden und alle Zitate, die verwendet werden sollen, genehmigt und gegebenenfalls umgeschrieben werden müssen. Bei allen Interviews ist eine Kommunikationsbeauftragte dabei, die das Gespräch aufzeichnet. Einer unserer Interviewpartner schaut immer wieder auf das Diktiergerät, das mitten auf
dem Tisch platziert ist. „Beim IWF zählt die Karrierelogik“, erklärt die Wissenschaftlerin Lara Merling vom Global Development Policy Center, einem Thinktank der Boston University. „Nur wer sich an die offizielle Linie hält, klettert in der Hierarchieleiter nach oben.“ Kritische Geister sind demnach weniger gefragt. In dieser Hinsicht, lässt sich nach unseren Eindrücken sagen, haben die meisten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ganz gute Aussichten.
Der IWF sorgt gut für seine 2400 Beschäftigten. Die Gehälter liegen zwischen 100 000 und 200 000 US-Dollar im Jahr. Wer eine Abteilung leitet, bezieht zwischen 320 000 und 400 000 US-Dollar. Aber auch Sekretärinnen und Sekretäre verdienen immerhin noch 42 000 bis 63 000 US-Dollar. Die meisten Gehälter werden brutto ausgezahlt, weil nur US-Angestellte Einkommensteuer zahlen müssen, hinzu kommen noch großzügige Lohnnebenleistungen. Dazu gehören etwa umfassende Sozialleistungen inklusive Altersvorsorge, den individuellen Bedürfnissen angepasste Möglichkeiten für Homeoffice, Sabbaticals und Unterstützungsangebote für die Familien der Beschäftigten.
Das Personal des IWF rekrutiert sich aus rund 160 von 190 Mitgliedstaaten und bildet einen eigenen kleinen Kosmos. Ein Großteil der akademischen Fachkräfte hat Elitehochschulen absolviert, etwa die École Polytechnique und die École Nationale d’Administration im Fall des französischen Kontingents. Und alle reden in einer Sprache, die selbstverständlich vom Englischen dominiert ist.
Doch es ist ein besonderes Englisch, eine Art von Marktkauderwelsch, dessen Wortschatz von den gesellschaftlichen Vorstellungen der neoklassischen Wirtschaftstheorie durchtränkt ist. Es fällt kein Satz ohne Begriffe wie „Stakeholder“, „Best Practices“ und „externe Effekte“.
Diese Sprache ist zudem mit hauseigenen Neologismen gespickt, die meist auch noch in Form von Abkürzungen daherkommen. Die Unverständlichkeit dieses Idioms ist eine der vielen unsichtbaren Mauern, die die Festung IWF vom Rest der Welt trennt. Außenstehende müssen sich anstrengen, etwa Sätze wie diese zu entschlüsseln: „Die MD hat im Austausch mit den CSO die IV zur CFM/MPM beschrieben.“ Soll heißen: Die geschäftsführende Direktorin hat im Austausch mit den Nichtregierungsorganisationen die neue Position der Institution in Bezug auf Kapitalverkehrskontrollen und makroprudenzielle Instrumente beschrieben.
Der US-Wissenschaftler James Raymond Vreeland begann sein 2007 erschienenes Buch über die mächtigste aller internationalen Finanzinstitutionen mit folgenden Sätzen: „Der IWF ist in der Dritten Welt weithin bekannt. Den Durchschnittsbürgern der Industrieländer ist er hingegen viel weniger vertraut.“2
Damals steckte der Fonds in einer existenzielle Krise. Wegen der bitteren Arznei, die er verabreichte, wandten sich die meisten Länder von ihm ab. In jenem Jahr versprach Argentiniens peronistische Präsidentschaftskandidatin Cristina Fernández de Kirchner in ihrem Wahlkampf, „eine Welt aufzubauen, in der euren Kindern und Kindeskindern der IWF kein Begriff mehr ist“.
Zwischen 2003 und 2007 sank die Kreditvergabe des IWF an notleidende Länder, die eigentlich seine Hauptaufgabe darstellt, von 110 Milliarden auf weniger als 18 Milliarden US-Dollar. Die Institution sei nur noch „ein Schatten ihrer selbst“, frohlockte damals der Ökonom Mark Weisbrot, der die Rolle des IWF bei der Vertiefung der globalen Ungleichheiten schon lange angeprangert hatte.3
Als der französische Sozialist Dominique Strauss-Kahn im September 2007 zum IWF-Präsidenten ernannt wurde, lautete sein Auftrag, das Personal deutlich zu reduzieren. Und das wenige Monate vor Ausbruch der Weltfinanzkrise von 2007/08. „Das war eine lächerliche Episode“, vertraut uns ein Mitarbeiter an, der wie die meisten internen Quellen anonym bleiben will: „Man hat den Leuten riesige Abfindungen angeboten, um sie loszuwerden. Einige davon musste man dann fast postwendend wieder einstellen!“
Der Sturm, der von der Wall Street ausging, hatte in kürzester Zeit Europa erreicht und Spanien, Irland, Italien, Portugal und Griechenland in Turbulenzen gebracht. Dadurch rückte der IWF wieder in den Vordergrund des Geschehens. Neu war allerdings, dass er erstmals in den Industrieländern intervenierte, wo sein Name den Menschen im Zuge der Krise ähnlich „geläufig“ wurde wie im Globalen Süden.
So kommt es, dass die drei Buchstaben 15 Jahre nach Vreelands Feststellung heute in aller Welt dasselbe Image vermitteln – das eines „Knecht Ruprecht“ des internationalen Finanzsystems. Seit der Finanzkrise sieht man auch in Europas Hauptstädten den IWF anprangernde Graffiti, die im Globalen Süden schon lange zum Stadtbild gehören. So konnte man 2011 in Lissabon, als eine IWF-Delegation mit der portugiesischen Regierung über ein Hilfspaket verhandelte, den Slogan „Injustiça, Miséria, Fome“ (Ungerechtigkeit, Elend, Hunger) auf den Mauern lesen – gemünzt auf die englische Abkürzung IMF (International Monetary Fund).
„Die Leute haben ein schlechtes Bild von uns, was häufig sehr ungerecht ist“, bekommen wir bei unseren – teilweise informellen – Gesprächen am IWF-Sitz zu hören. Hier spricht man lieber über die großen Leitprinzipien, die bei der Konferenz von Bretton Woods 1944 – der Geburtsstunde des IWF – verkündet wurden: Koordination, Gemeinschaft und Austausch. 78 Jahre später, so heißt es, seien diese Werte für den Fonds noch immer der Kompass für seine beiden Tätigkeitsfeldern „Aufsicht“ und „Unterstützung“.

Fatale Fehleinschätzung im Fall Griechenland
„Artikel IV der Statuten sieht vor, dass alle Mitgliedstaaten einmal jährlich von einer Delegation des Internationalen Währungsfonds besucht werden, damit im Rahmen der Aufsichtsmission des IWF die Wirtschaftslage des betreffenden Landes besprochen werden kann“, erklärt Christoph Rosenberg, stellvertretender Direktor der Kommunikationsabteilung des IWF. „In den meisten Fällen werden unsere Teams direkt vom Finanzminister und vom Präsidenten der Zentralbank empfangen.“
Nach jeder Mission veröffentlicht der IWF eine Analyse der ökonomisch-politischen Situation mit seinen Empfehlungen. Der letzte Bericht für Frankreich datiert vom 26. Januar 2022 und ist 83 Seiten stark. Darin werden der Regierung in Paris folgende Maßnahmen empfohlen: die Umsetzung der von Emmanuel Macron geplanten Rentenreform gegen den „Widerstand in der Bevölkerung“, eine mehrjährige Haushaltskonsolidierung, was im Klartext eine Reduzierung der staatlichen Ausgaben bedeutet, und die Liberalisierung der „nichtkommerziellen Dienstleistungen“, einschließlich des öffentlichen Dienstes.
„Einige Länder werden unter intensive Aufsicht gestellt, wenn unsere Teams Probleme kommen sehen“, erläutert Rosenberg. Für die anderen sei die Inspektion eher eine Formalität.“ 2007 gehörte Griechenland noch zu dieser zweiten Kategorie. Der damalige IWF-Bericht klang beruhigend: „Der Bankensektor macht einen gesunden Eindruck, verzeichnet hohe Renditen und verfügt über solide Kapital- und Liquiditätspositionen. Wir rechnen mit Wachstumsraten deutlich über dem Euroraum-Durchschnitt.“ Zwei Jahre später legte die Eurokrise offen, wie fragil die Wirtschaft und die Staatsfinanzen Griechenlands tatsächlich waren.4
In ehemals kolonisierten und folglich „rückständigen“ Ländern ist die Hilfe des IWF meist technischer Natur. „Auf Dienstreisen in Afrika ist es mir schon passiert, dass ich hohen Beamten Englischunterricht geben musste“, berichtet ein Mitarbeiter. „Manchmal kommt man in ein Land und stellt fest, dass die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung in Excel erstellt wird. Und anderswo gibt es nicht einmal Computer“, erzählt der junge Volkswirt. „Manchmal verfassen wir dann für sie die Jahresberichte.“ Dass diese Form von Hilfe leicht als Bevormundung wahrgenommen wird, sollte nicht verwundern.
Die wichtigste Unterstützung, die der IWF seinen Mitgliedstaaten bietet, ist allerdings monetärer Art und erfolgt in Form von Darlehen. „Jedes Mitglied mit Zahlungsbilanzschwierigkeiten kann unsere Finanzhilfe beantragen“, erklärt Rosenberg. Einem Land, das mit solchen Problemen zu kämpfen hat, fehlen schlicht die nötigen Gelder in harter Währung, um seine Schulden zu bedienen oder die nötigen Lebensmittel zur Ernährung der Bevölkerung zu importieren. Das ist derzeit zum Beispiel in Sri Lanka der Fall (siehe den Artikel auf Seite 5).
Laut Rosenberg kommt das Verfahren in Gang, indem die lokalen Behörden die IWF-Vertretung in ihrem Land anrufen. Es folgt ein Vorbereitungstreffen, bei dem seitens des IWF die Bedingungen einer möglichen Intervention skizziert werden. „Der IWF gewährt Kredite nur auf Grundlage eines Anpassungsprogramms zur Bewältigung der Probleme, die die Krise ausgelöst haben“, betont Rosenberg.
Um sicherzustellen, dass der Reformwille der in die Krise gerutschten Länder im Lauf der Zeit nicht nachlässt, erfolgt die Auszahlung in Tranchen. Bei Missachtung der Verpflichtungen werden die Zahlungen eingestellt. Ganz nach dem Motto: „Wir sind keine Wohltätigkeitsorganisation“, das Strauss-Kahn in seiner Zeit als IWF-Chef ständig gepredigt hat.5
Von dieser „Konditionalität“, also der Bindung der Kreditvergabe an bestimmte Kriterien, war in der Frühphase des IWF keine Rede. Doch die hat sich seitdem zu einem der Hauptmerkmale des Verfahrens entwickelt. Der Vertrag, den Peru 1954 unterzeichnete, war nur 2 Seiten lang – der Vertrag, den Athen 2010 mit dem IWF abschloss, hatte 64 Seiten.
Mittlerweile knüpft die Organisation die Kreditvergabe an Kriterien wie die Zahl der Beamten, die Reform von Staatsbetrieben oder des Sozialsystems und an „Fortschritte“ bei der Privatisierung. „Es sind äußerst harte Maßnahmen, die ohne nennenswerte Narkose durchgeführt werden müssen“, schrieb Michel Camdessus, IWF-Chef von 1987 bis 2000, in seinen Memoiren: „Im Grunde handelt es sich um Kriegschirurgie.“6
Gezielte Nachsicht mit der Ukraine
Im Laufe eines etwa zweiwöchigen Aufenthalts und nach Gesprächen mit dem Zentralbankchef, Vertretern des Finanzministeriums und des Statistikamts macht sich das IWF-Team ein Bild von der Lage und verfasst anschließend zusammen mit den lokalen Behörden eine Absichtserklärung (Letter of Intent). Dieser Brief geht an die Zentrale. „Es handelt sich um eine Art Vertrag“, der Resultat eines „gemeinsamen Schreibprozesses“ ist, erklärt der Kommunikationschef Rosenberg.
Ein mittlerweile berühmtes Foto, aufgenommen am 15. Januar 1998, erzählt eine etwas andere Geschichte: Es zeigt den damaligen IWF-Chef Camdessus, der mit verschränkten Armen und strengem Blick beobachtet, wie der indonesische Präsident Mohamed Suharto unterschreibt. Suharto sah sich damals „aus Ohnmacht gezwungen, die wirtschaftliche Souveränität seines Landes an den IWF abzugeben, um im Gegenzug die benötigte Unterstützung zu erhalten“.7. Das schreibt Joseph Stiglitz, der damals Chefökonom der Weltbank war. Man kann davon ausgehen, dass die indonesischen Behörden damals kein einziges Wort des von Suharto unterzeichneten Schriftstücks selbst verfasst hatten. Was die Regel gewesen sein dürfte.
Das Dokument ist angeblich „eine Art Vertrag“. Ein internationales Abkommen ist es deshalb aber nicht. In vielen Ländern muss der Text im Parlament debattiert und ratifiziert werden. Einem solchen Verfahren geht der IWF lieber aus dem Weg. Das lässt schon eine Anweisung erkennen, die einer seines Exekutivdirektoriums am 2. März 1979 erlassen hat. Sie besagte, dass in den IWF-Texten „jegliche an Verträge erinnernde sprachliche Wendungen zu vermeiden“ seien.
Bevor überhaupt der erste Dollar fließt, verpflichten sich deshalb manche Regierungen „aus freien Stücken“ dazu, die enorm schwierigen Reformen umzusetzen. „Uns geht es darum, eine Geste des guten Willens zu erhalten und sicherzustellen, dass die Regierenden es ernst meinen“, erläutert Rosenberg. Dass die Bittsteller aufmucken, komme kaum jemals vor. „Im Allgemeinen brauchen die Länder, die an die Tür des IWF klopfen, das Geld so dringend, dass sie in alles einwilligen.“
Mitunter liegt die Geheimhaltung der Verhandlungsinhalte auch im Interesse der Regierungen, weil sie unpopuläre Maßnahmen auf den IWF schieben können. Ein Gesprächspartner zitiert den Spruch, der auf den Fluren des IWF oft zu hören sei: „Wir werden dafür bezahlt, die Rolle des großen bösen Wolfs zu spielen.“
Die „Absichtserklärung“ landet am Ende beim IWF-Exekutivdirektorium. Der Grundsatz „ein Land, eine Stimme“, der in der UN-Vollversammlung gilt, wird hier geflissentlich ignoriert. Die Stimmrechtsanteile der Mitgliedstaaten bemessen sich seit der Gründung der Organisation vor allem an den Finanzierungsquoten der Länder – mit dem Resultat, dass die USA über ein Vetorecht verfügen. Deren Stimmrechtsanteil lag nie unter der für eine Sperrminorität erforderliche Schwelle von 15 Prozent.
Ein seltsames Überbleibsel vergangener Zeiten ist die Zusammensetzung des Exekutivdirektoriums, in dem sieben Staaten einen ständigen Sitz haben: die USA, Frankreich und Großbritannien sowie Deutschland (seit 1960), Japan (seit 1970), Saudi-Arabien (seit 1978) und China (seit 1980).
Die restlichen 17 Sitze werden von Exekutivdirektoren übernommen, die jeweils verschiedene und – geografisch durchaus disparate – Ländergruppen repräsentieren. Ein Beispiel: Derzeit sitzen in dem Gremium der Kanadier Philip John Jennings und sein irischer Stellvertreter Feargal O’Brolchain, die neben ihren eigenen Ländern auch Antigua und Barbuda, die Bahamas, Barbados, Belize, die Dominikanische Republik, Grenada, Jamaika, St. Christopher und Nevis, St. Lucia und St. Vincent und die Grenadinen vertreten.
Das Exekutivdirektorium verhindert die Beschlussfassung so lange, bis Einstimmigkeit erreicht ist. Camdessus hat dies einmal mit der Qualität der Vorarbeit durch einen permanenten Dialog zwischen Exekutivdirektorium und Generaldirektion begründet, wobei er davon ausgeht, dass die Exekutivdirektoren unabhängig von ihrem Herkunftsland eine Art kollektive Weisheit entwickelt haben.
Der Wissenschaftler Vreeland hat für diese „Tradition“ eine andere Erklärung: „Weil kleinere Länder eine etwaige Opposition zu den USA nicht durch Blockabstimmungen zum Ausdruck bringen können, müssen sie diese jeweils einzeln äußern. Die Macht, die die USA nicht nur im IWF, sondern generell besitzen, schüchtert diese Akteure tendenziell ein.“8
In dieser Phase des Prozesses gibt es einen regen Austausch zwischen der IWF-Generaldirektion und den verschiedenen Exekutivdirektoren. Geringfügige Änderungen eröffnen schließlich den Weg zum dem ersehnten Konsens. Wenn das Exekutivdirektorium grünes Licht gegeben hat, wird die erste „Liquiditätstranche“ binnen zwei Stunden auf das Konto des Empfängerlands überwiesen.
Doch auch ein so penibel geregeltes Verfahren kann aus dem Ruder laufen. Wenn nämlich alle informellen Absprachen nicht zum Ziel führen, kann es zur Katastrophe kommen. Das berichteten alle unsere Gesprächspartner mit sorgenvoller Miene. So gab es Fälle, in denen ein Exekutivdirektor so weit ging, sich unter den vorwurfsvollen Blicken seiner 23 Kolleginnen und Kollegen der Stimme zu enthalten. So was ist keine Bagatelle: Wenn das Prinzip der Einstimmigkeit nicht gewahrt bleibt, gerät der Mythos einer durch Sachverstand und Kooperationswillen zusammengeschweißten „internationalen Gemeinschaft“ ins Wanken.
„Der IWF ist eine hochgradig technische Institution. Seine Kreditvergabe erfolgt im Rahmen kodifizierter Verfahren, die von vornherein jegliche Willkür ausschließen. Doch wenn die politischen Prioritäten eines der mächtigen Länder ins Spiel kommen, tritt der Fonds seine eigenen Regeln mit Füßen“, kritisiert Paulo Nogueira Batista Jr., der zwischen 2007 und 2015 für Brasilien und zehn weitere Länder im Direktorium saß. Batista hat sich zweimal bei Abstimmungen enthalten – eine betraf Griechenland, eine andere die Ukraine.
2008 und 2010 klopfte Kiew beim IWF an. Der verordnete derart strenge Einsparungen, dass Präsident Janukowitsch 2013 deren Umsetzung stoppte. Daraufhin setzte der IWF seine Zahlungen aus. Dafür sprang Moskau mit einem 3-Milliarden-Dollar-Kredit ein. Nach den Massenprotesten auf dem Maidan wurde der Kreml-Schützling Wiktor Janukowitsch 2014 gestürzt, in einer Nacht-und-Nebel-Aktion nach Russland ausgeflogen und durch Petro Poroschenko ersetzt, der das prowestliche Lager vertrat. Und siehe da: Der IWF gab wieder Geld – ein Darlehen über 18 Milliarden US-Dollar.
Normalerweise kann ein solcher Betrag nur bewilligt werden, wenn mehrere Bedingungen erfüllt sind. Unter anderem darf sich das Land nicht im Krieg befinden. Damals aber waren in der Ostukraine bereits schwere Kämpfe ausgebrochen. Die ukrainische Regierung zeigte sich entschlossen, die vom IWF geforderten Reformen umzusetzen. Allerdings hatte die politische Klasse – ob unter Janukowitsch oder Poroschenko – sowohl bei der ukrainischen Bevölkerung9 als auch international keinen guten Ruf. Sie galt schon in den 1990er Jahren als unzuverlässig, erinnert sich der Brasilianer Nogueira.
Außerdem muss der Antragsteller in der Lage sein, seine Schulden zurückzuzahlen. In diesem Punkt hatten die Fachabteilungen begründete Zweifel. Daher drängte der IWF 2015 bei Kiews privaten Gläubigern erfolgreich auf einen 20-prozentigen Teilerlass aller ausstehenden Forderungen und auf die Streckung des Rückzahlungszeitraums für die Restschulden. Die französische Tageszeitung Le Monde bezeichnete diese Geste seinerzeit als „sehr politisch“.10
Eine andere Episode aus demselben Jahr zeigt, wie flexibel der IWF sein kann. Am 20. Dezember 2015 musste Kiew finanzielle Forderungen Moskaus zurückzahlen, wollte es nicht als „gegenüber einem staatlichen Gläubiger im Zahlungsrückstand befindlich“ eingestuft werden. In einer solchen Situation dürfen laut den Kreditregeln des IWF keine weiteren Zahlungen fließen.
Putschversuch gegen die neue Chefin
Am 8. Dezember 2015, also kurz vor Ablauf der Frist, verkündete IWF-Sprecher Gerry Rice auf einer Pressekonferenz, das Exekutivdirektorium habe „beschlossen, seine Null-Toleranz-Politik in Bezug auf Zahlungsrückstände gegenüber staatlichen Gläubigern zu ändern“. So konnte der IWF seine Unterstützung für Kiew fortsetzen, obwohl die ukrainische Regierung zum 21. Dezember 2015 gegenüber Moskau in Zahlungsrückstand geriet.
Als Griechenland den IWF 2010 um Unterstützung ersuchte, war seine Staatsverschuldung ebenso wenig „tragfähig“ wie die der Ukraine. „Normalerweise hätte es der Fonds ablehnen müssen, ohne Umstrukturierung dieser Schuldenlast zu intervenieren“, meint Nogueira Batista Jr. „Doch die Europäer, allen voran Deutschland und Frankreich, wollten ihre Banken – die Gläubiger Griechenlands – schützen. Sie zögerten die Umstrukturierung so lange hinaus, bis ihre Banken bis auf den letzten Euro ausbezahlt waren.“
Der IWF entschied sich damals also für eine Politik des Laisser-faire. Als das griechische Wahlvolk dann 2015 mit Alexis Tsipras einen Ministerpräsidenten wählte, der die Austeritätspolitik ablehnte, „wurde die Situation politisch“, erklärt unser Gesprächspartner. „Ich gehörte zu jenen im IWF, die fragten:,Müssen wir nicht berücksichtigen, dass die Griechen gegen unser Programm gestimmt haben?‘“ Darauf habe er die Antwort erhalten, auch die Regierungen in Frankreich oder Deutschland seien demokratisch gewählt, und deren Wähler wollten „nicht für die Fehler anderer zahlen“.
In dem einen Fall wird ein Land, das in finanziellen Schwierigkeiten steckt, aus „Verantwortungsbewusstsein“ in die Knie gezwungen; in dem anderen Fall fühlt man sich zu großzügigem Verhalten genötigt. „Immer wieder bekamen wir gesagt:,Die Ukraine hat Priorität! Wir müssen unbedingt intervenieren‘ “, erinnert sich Nogueira. Dabei ist auch Russland ein Mitglied des IWF, argumentiert einer unserer Interviewpartner: „Der Fonds hätte sich nicht in einen Konflikt zwischen zwei Vollmitgliedern einmischen dürfen.“
„Nicht intervenieren“ lautet offenbar auch die Losung des IWF im Fall Venezuela. Die Organisation erklärt, sie fühle sich nicht in der Lage, zu beurteilen, wer hier der legitime Staatschef sei: der in einer von der Opposition boykottierten Wahl gewählte Präsident Nicolás Maduro oder sein von Washington unterstützter Gegenspieler Juan Guaidó. Nach dem Staatsstreich gegen Hugo Chávez von 2002 sah der IWF aber kein Problem darin, mit den Putschisten und gegen die demokratisch gewählte Regierung zusammenzuarbeiten.11
Ein machtvolles Instrument wie den IWF gibt natürlich niemand freiwillig aus der Hand. Deshalb ist es so schwierig, eine Stimmrechtsreform zu erreichen, mit der auch die Mitglieder zufriedengestellt wären, die nicht dem „Westblock“ angehören. Die weitreichendste Veränderung des Kräfteverhältnisses im Exekutivdirektorium datiert aus dem Jahr 2010. Damals sank der Stimmrechtsanteil der USA von 16,7 auf 16,5 Prozent, während der Anteil Chinas von 3,8 auf 6 Prozent und der Indiens von 2,3 auf 2,6 Prozent stieg. Die größten Stimmrechtsverluste mussten die europäischen Länder hinnehmen.
Es dauerte sechs Jahre, bis der US-Kongress grünes Licht für die Reform gab. „Die entscheidende Wende trat ein, als Außenministerin Hillary Clinton das Projekt an sich riss, für das zuvor Finanzminister Timothy Geithner zuständig war“, sagt ein Exekutivdirektor, der nur unter der Bedingung der Anonymität mit uns sprechen wollte. Mit diesem Schritt sei eine ökonomischen Frage zu einer geopolitischen geworden. Die Neuaufteilung der Stimmrechte innerhalb des IWF sei zudem Teil eines „umfassenden Angebots“ gewesen, das die USA damals China unterbreitet hätten. Washington habe den Aufbau einer „G2“ in Aussicht gestellt, als exklusives Koordinationsforum für die beiden Kolosse der Weltwirtschaft. Auch deshalb wurde der chinesische Renminbi zur internationalen Reservewährung befördert.
Die Voraussetzungen für eine weitere bedeutsame Stimmrechtsreform sind nach Meinung vieler Beobachter zurzeit nicht gegeben. „Wir Länder des Globalen Südens haben begriffen, dass die von den Europäern und den USA auf dem G20-Gipfel von 2008 versprochene IWF-Reform nicht kommen wird“, sagt Nogueira Batista Jr. Derweil verstärkt China seit 2010 seine Bemühungen, auf regionaler Ebene neue Finanzinstitutionen wie die Asiatische Infrastruktur-Investitionsbank (AIIB) zu etablieren.
Während die weltweite Verschuldung der öffentlichen Hand und der privaten Haushalte 2020 sprunghaft angestiegen ist – um 28 Prozentpunkte auf 256 Prozent des weltweiten Bruttoinlandsprodukts –, geht beim IWF mittlerweile die Angst um. Dabei habe die vom IWF vorangetriebene Finanzliberalisierung jahrelang zur Verschärfung der Krisen beigetragen, erklärt uns ein Mitarbeiter. Eine Aufstockung der IWF-Mittel hätte allerdings Auswirkungen auf die Verteilung der Stimmrechte, denn die hängen von den Quoteneinzahlungen der einzelnen Länder ab. „Das ist ungefähr so, wie wenn sich ein Brand auf die zehnfache Fläche ausweitet, der Durchmesser des Feuerwehrschlauchs aber gleich bleibt.“
So bleibt im Grunde nichts anderes übrig, als Schulden umzustrukturieren. Das erscheint auch logisch, denn Umschuldungen sind ein Spezialgebiet des IWF. Dabei nutzt der Fonds seine Überzeugungskraft gegenüber den Gläubigern, um entsprechende Verhandlungen zu erzwingen. Allerdings stehen die armen Länder mit der Hälfte ihrer Verbindlichkeiten bei China in der Kreide. Und nichts deutet darauf hin, dass sich die Volksrepublik mit einer Institution abstimmen möchte, von der sie bisher geschnitten wurde. In Zukunft könnte China auch selbst entscheiden, zu welchen Bedingungen es krisengeplagte Staaten „unterstützt“. Diese Aussicht findet man in Washington gar nicht lustig.
Vor über 20 Jahren hat der Nobelpreisträger Stiglitz den IWF mit dem berühmten Vorwurf konfrontiert, die Interessen der Finanzwelt zu vertreten. Daran hat sich seitdem zwar nichts geändert, doch mittlerweile lässt sich kaum leugnen, dass sich die Organisation noch von einem anderen Kompass leiten lässt: den geopolitischen Prioritäten des Westens.
Im Januar 2021 setzte eine interne Untersuchung die aktuelle IWF-Chefin Kristalina Georgiewa unter Druck. Ihr wurde vorgeworfen, sie habe in ihrer Zeit bei der Weltbank einen Bericht zugunsten Chinas geschönt. In der Wirtschaftspresse wurden daraufhin Rücktrittsforderungen laut. Nach Meinung von Stiglitz und Weisbrot handelte es sich um einen „versuchten Staatsstreich“ seitens der USA.12 Schließlich dürfte Georgiewa kaum allein gehandelt haben. Aber die Bulgarin hatte dem US-amerikanischen Vizedirektor David Lipton gekündigt. Ihre Vorgängerin Christine Lagarde hatte sich laut Economist noch „damit begnügt, als Aushängeschild des Fonds zu fungieren, während Lipton die Geschäfte führte.“13
Als der Putsch gescheitert war, beförderte US-Finanzministerin Janet Yellen besagten Lipton zum Chefberater in ihrem Ministerium – mit Zuständigkeit für alle den IWF betreffenden Fragen. Nach dem offiziellen Organigramm hält Georgiewa im IWF nach wie vor die Zügel in der Hand. Doch die tatsächlichen Machtverhältnisse verraten, wer der Gewinner ist. Weisbrot formuliert es so: „Unter dem Strich sind IWF und US-Finanzministerium ein und dasselbe.“
1 Der Autor dankt Dominique Plihon für seine freundliche Unterstützung.
3 Mark Weisbrot, „The IMF has lost its influence“, The New York Times, 22. September 2005.
7 Joseph E. Stiglitz, „Die Schatten der Globalisierung“, Berlin (Siedler) 2002.
9 Siehe die Umfragen bei Klaus Müller, „Die Clans der Ukraine“, LMd, Oktober 2014.
10 Le Monde, 1. September 2015.
11 Siehe Ignacio Ramonet, „Operation Condor II“, LMd, Juni 2002.
12 Joseph E. Stiglitz, „Putschversuch beim IWF“, Project Syndicate, 27. September 2021.
13 „The IMF undergoes structural reform“, The Economist, London, 15. Februar 2020.
Aus dem Französischen von Markus Greiß




