Trauerspielin Rot
von Benoît Breville und Serge Halimi
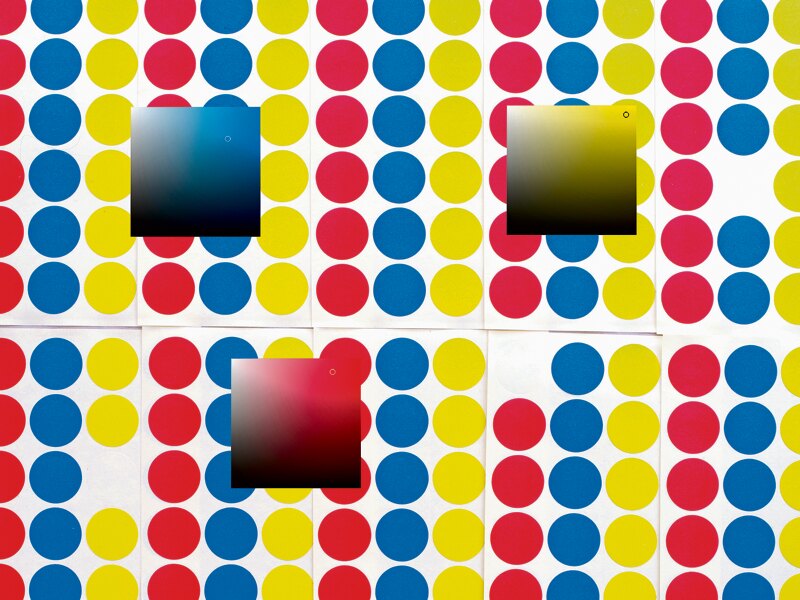
Drei Monate vor den französischen Präsidentschaftswahlen rechnen wohl die meisten damit, dass die Linke wieder einmal verlieren wird. Selbst wenn sie sich für diese Wahl überraschenderweise noch zusammenschließen würden – die diversen Strömungen, aus denen die linke „Familie“ besteht, haben nicht mehr viel gemeinsam.
Wie könnten sie zusammen regieren, wenn sie sich bei so grundlegenden Fragen wie der Steuerpolitik, dem Renteneintrittsalter, der Europäischen Union, der Energiegewinnung durch Atomkraft, der Verteidigungspolitik oder den Beziehungen zu Washington, Moskau und Peking uneins sind? Das Einzige, was sie noch eint, ist die Angst vor den Rechtsextremen. Deren Aufstieg hält seit vier Jahrzehnten an, 20 Jahre davon (1981–1986, 1988–1993, 1997–2002, 2012–2017) war die Linke an der Macht. Ihre Strategien, um die Gefahr von rechts einzudämmen, sind also grandios gescheitert.
In anderen Ländern sieht es nicht besser aus. „Wir müssen nicht lang drum herumreden. Wir gehen unter. In ziemlich vielen Ländern ist die Linke erledigt“, gesteht Jean-Luc Mélenchon, der Vorsitzende von La France insoumise.1 Unter den Linken dürfte er als Kandidat die besten Chancen haben, aber insgesamt liegt er hinter mehreren rechten und rechtsextremen Kandidatinnen. 2002 regierten die Sozialdemokraten in 13 von 15 EU-Ländern. 20 Jahre später sind sie nur noch in 7 von 27 EU-Staaten an der Regierung beteiligt (Deutschland, Finnland, Schweden, Dänemark, Spanien, Portugal und Malta). Dieser Absturz hat mit einem schlimmen Paradox zu tun, das der linksrepublikanische Politiker Jean-Pierre Chevènement folgendermaßen beschreibt: „Die neoliberale Globalisierung mit der Freizügigkeit für Waren, Dienstleistungen, Kapital und Menschen wird nicht von der Linken infrage gestellt, bei der inzwischen der Sozialliberalismus vorherrscht, sondern von der sogenannten populistischen Rechten.“2
Dabei hätte diese Entwicklung eigentlich der „linken Linken“ Auftrieb geben müssen. Danach sieht es aber nicht aus. In Griechenland wurde die Syriza von ihren Gläubigern zu der harten Wirtschafts- und Finanzpolitik gezwungen, die sie bekämpfen wollte3 ; sie hat sich gebeugt und die Macht verloren. Podemos in Spanien (siehe den Beitrag auf Seite 14 f.) und Die Linke in Deutschland sind geschwächt. Die französischen Kommunisten stellen keinen einzigen Abgeordneten mehr im Europaparlament. Und das ist noch nicht alles. Jeremy Corbyn, der als Parteiführer versucht hat, die britische Labourpartei aus dem Blair’schen Fahrwasser herauszulotsen, sitzt inzwischen im Unterhaus bei den Fraktionslosen. In den USA hat sich Bernie Sanders darum bemüht, der demokratischen Partei, die tatkräftig an der neoliberalen Globalisierung mitgewirkt hatte, eine neue Identität zu geben. Er scheiterte jedoch in den Vorwahlkämpfen 2016 und 2020. Nur in Lateinamerika gibt es für die Linke hier und da noch Hoffnung (siehe den Beitrag auf Seite 1 f.).
Der Versuch einer gesellschaftlichen Veränderung muss sich auf eine starke Bewegung von unten stützen. Bekanntlich kann man das Versagen einer Politik oder gar die Unrechtmäßigkeit eines Systems erkennen, ohne dieses System auch beseitigen zu wollen. Wenn die nötigen Instrumente fehlen, fällt die Wut oft in sich zusammen; man schlägt sich dann so durch oder gelangt zu der festen Überzeugung, die sozialen Rechte des Nachbarn seien Privilegien.
Das ist der Nährboden für Konservative und Rechtsextreme. In Frankreich und anderswo ist das Scheitern der meisten großen Sozialbewegungen in den letzten 20 Jahren teilweise auf ineffiziente Strategien der Gewerkschaften zurückzuführen, während die Bourgeoisie aus ihren Niederlagen lernt und weiß, wie man die Instrumente, die dazu geführt haben, zerstört. Sie ändert die Spielregeln oder bricht sie skrupellos. So schrieb der Philosoph Lucien Sève: „Der Kapitalismus wird nicht von selbst zusammenbrechen, er hat noch die Kraft, uns alle mit in den Tod zu reißen, wie der lebensmüde Flugzeugpilot seine Passagiere. Wir müssen das Cockpit stürmen, um gemeinsam den Steuerknüppel rumzureißen.“4
Oft genug hat die Linke im Cockpit gesessen. Doch genau das ist heute ihr Handicap. Die Erinnerung daran lässt die Leute zögern, ihr erneut das Heft in die Hand zu geben. Namen wie Blair, Clinton, Mitterand, Craxi, Gonzales, Schröder oder Hollande provozieren oft eine heftige Abwehr. Man muss schon in einem Stapel Schwarz-Weiß-Fotos wühlen, damit das Wort „links“ noch Wehmut auslöst: New Deal, Front Populaire oder „Spirit of ’45“, dem die Briten ihr Gesundheitssystem verdanken.
Die Geschichte der Enttäuschungen – vor allem in den letzten Jahren – muss hier nicht ausgebreitet werden. Zwei grundlegende Aspekte lohnt es sich aber zu erwähnen: Zum einen ist die Linke nicht einfach dabei gescheitert, ihr eigenes Programm zu verwirklichen, sie hat vielmehr das ihrer Gegner umgesetzt. Und zum anderen erfolgte jedes Mal – so sie nicht vorschnell kapitulierte wie Präsident Hollande seit dem allerersten Tag seiner Amtszeit – weder ein Staatsstreich noch der Einmarsch fremder Truppen, sondern die finanzielle Strangulierung. „Der Athener Frühling wurde ebenso zerschlagen wie der Prager Frühling. Nur nicht von Panzern, sondern von den Banken“, erklärte 2015 der griechische Finanzminister Yannis Varoufakis.
Oft saß der Feind im Innern. Bis vor Kurzem hätte sich niemand vorstellen können, dass ein früherer Premierminister der Labourpartei (Tony Blair) in die Privatwirtschaft wechseln und mit seinen Diensten für die Barclaybank und JP Morgan reich werden würde oder dass ein früherer sozialistischer Finanzminister (Dominique Strauss-Kahn) Direktor des Internationalen Währungsfonds (IWF) werden könnte. Gleich drei französische Sozialisten oder Mitterand-Vertraute haben maßgeblich an der Deregulierung der Finanzmärkte mitgewirkt: Jacques Delors als Präsident der Europäischen Kommission, Henri Chavranski an leitender Position in der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und Michel Camdessus als IWF-Direktor.
Öffentlich-private Partnerschaften (Public Private Partnerships, PPP) und Privatisierungen, auch die der Medien, wurden oft von Linken vorangetrieben. Als der sozialistische Ministerpräsident Lionel Jospin 2002 seine Kandidatur für die Präsidentschaftswahlen erklärte, behauptete er gar, die von seiner Regierung beschlossene Privatisierung von France Télécom und Air France sei „im Interesse der Beschäftigten“ gewesen. Wie will man mit einer solchen Bilanz eine linke Wählerschaft mobilisieren?
Wenn die Linke an der Macht ist, sich aber weigert, gegen rechte Politik die Führung zu übernehmen, ist es allerdings auch nicht einfacher. Vor fast einem Jahrhundert äußerte der sozialistische Politiker Léon Blum am Vorabend der Parlamentswahl von 1924 für den Fall eines Siegs der Linken seine Sorge: „Wir sind nicht sicher, ob die Vertreter und Regierenden der heutigen Gesellschaft nicht selbst den Pfad der Legalität verlassen, wenn sie ihre Grundprinzipien zu sehr bedroht sehen.“5 Blum fürchtete einen Staatsstreich. Ein solcher ist heute nicht mehr nötig, man muss den Pfad der Gesetzmäßigkeit nicht verlassen, damit die Grundprinzipien der kapitalistischen Gesellschaft weiter gelten, egal, was die betroffene Bevölkerung beschließt.
Nur vier Tage nach dem Parlamentssieg der griechischen Linken warnte der Präsident der Europäischen Kommission Jean-Claude Juncker die Sieger: „Es kann keine demokratische Entscheidung gegen die europäischen Verträge geben.“ Diese verhärteten Strukturen, das Gefühl, alles sei unmöglich geworden, sind inzwischen so tief in den Texten und in den Köpfen der Regierenden verankert, dass Finanzminister Bruno Le Maire kürzlich auf die Mitteilung, 90 Prozent der Franzosen seien für die Abschaffung der Mehrwertsteuer auf 50 Grundbedarfsgüter, nur antwortete: „Darüber müssten wir jahrelang mit der Europäischen Kommission verhandeln, denn im Rahmen der aktuellen Vorschriften ist eine Mehrwertsteuer von null Prozent nicht möglich.“6 Wir würden ja gern, aber wir können nicht …
Dass sich die Politiker so oft auf die eigene Ohnmacht berufen, hat die politische Debatte in Verruf gebracht. Die Parteien verlieren ihre Mitglieder (vor 40 Jahren hatte die Sozialistische Partei Frankreichs 200 000 Mitglieder, heute sind es noch 22 000), und sie gelten nicht mehr als Weichensteller des Wandels, sondern als Wahlmaschinen, als Apparat, in dem man unter sich bleiben, Hahnenkämpfe austragen und sein Ego polieren kann.

Resignation und Fatalismus
Um sich von diesen Organisationsformen abzugrenzen, wenden sich viele Aktivisten anderen Bewegungen zu, die horizontaler, inklusiver und partizipativer sind; man denke etwa an die Demonstranten des Arabischen Frühlings, an Occupy Wall Street, Nuit Debout oder die Gelbwesten: Sie alle lehnten es ab, Anführer zu wählen (aus Angst vor der Personalisierung), hierarchische Strukturen zu schaffen (aus Angst vor dem Autoritarismus), Bündnisse mit Parteien oder Gewerkschaften einzugehen (aus Angst vor Vereinnahmung) oder sich am Spiel der Wahlen zu beteiligen, das mit Machenschaften und Kompromissen gleichgesetzt wird.
Dieser Drang nach moralischer Integrität geht allerdings auf Kosten der Effizienz. Am 15. Oktober 2011 hat die Occupy-Bewegung Millionen Menschen in 952 Städten in 82 Ländern auf die Straße gebracht – die größte weltweite Demonstration der Geschichte. Erreicht hat sie nichts. Die Gelbwesten haben dutzende Samstage demonstriert – die längste soziale Bewegung in Frankreich. Auch sie haben nicht viel erreicht. Und der Arabische Frühling? Zehn Jahre nach den Kundgebungen auf dem Tahrirplatz in Kairo leidet das Land unter der Diktatur von Abdel Fattah al-Sisi, die noch schlimmer ist als die des 2011 gestürzten Präsidenten Husni Mubarak.
„Die jungen Leute, die diese Bewegungen geführt haben, lehnten jede Form einer vertikalen Organisation ab“, erklärt der Politikwissenschaftler Hicham el Alaoui. „Warum? Weil sie dem politischen System nach Jahrzehnten der Korruption misstrauten, es als schmutzig und korrumpiert ansahen. Um ihren Idealismus zu bewahren, mussten sie rein bleiben.“7 Allerdings könne man noch so viel Druck auf der Straße machen. „Wenn dieser Druck nicht im politischen System ankommt, bleibst du draußen.“ In solchen Fällen ist die Gleichung simpel: ohne Organisation kein Einfluss, ohne Einfluss keine Ergebnisse.
Das hat zu Resignation oder gar Fatalismus geführt. Und zu der Suche nach anderen Wegen. Weil Millionen Menschen auf der Straße nicht ausreichen, um die Welt zu ändern, ziehen viele Aktivistinnen inzwischen lokale Alternativen vor und engagieren sich in konkreten Initiativen, mit denen sie die gesellschaftliche Ordnung unterlaufen können, etwa in Autonomen Zonen oder selbstverwalteten Kommunen. Wer sich aus dem System ausklinkt, findet sich allerdings damit ab, das Wesentliche nicht ändern zu können.
„Man verändert die gesellschaftlichen Beziehungen nicht, indem man sich ihnen entzieht. Eine antikapitalistische Insel schafft den Kapitalismus nicht ab: Sie überlässt ihm das ganze Festland“, sagt der Ökonom und Soziologe Frédéric Lordon. Dennoch zeige es, dass die Bewegung lebt. „Das ist von unschätzbarem Wert. Allerdings nur, wenn auch die Rückkehr aufs Festland vorbereitet wird.“7 Aber erreichen Bewegungen wie die Zones à Defendre (ZAD), die oft von jungen Leuten aus der gebildeten Mittelklasse gegründet werden, auch die sozial Schwächeren?
Wenn wir über das Scheitern der Linken nachdenken, müssen wir den Blick auf das Bündnis zwischen den Klassen richten. Nur durch sie konnte die Linke im Verlauf des 20. Jahrhunderts die Gesellschaft verändern. Heute ist dieses Bündnis zerschlagen. Die gemeinsame Front aus progressiver Mittelklasse und prekärer Unterklasse hat sich aufgelöst. Beide Gruppen finden nicht mehr zueinander, zu weit ist die räumliche und schulische Segregation schon gediehen. Sie haben aufgehört, in politischen Parteien zusammenzuarbeiten, die heute mehrheitlich aus bürgerlichen Hochschulabsolventinnen und Rentnern bestehen. Sie setzen sich nicht mehr für dieselben Dinge ein, haben nicht mehr dieselben Prioritäten.
Die Spaltung zwischen der Linken und den Unterklassen in den letzten 30 Jahren wurde durch verschiedenste Faktoren erklärt: politische (Verrat an eingegangenen Verpflichtungen), wirtschaftliche (Ausweitung des Dienstleistungssektors, Finanzialisierung der Wirtschaft), ideologische (neoliberale Hegemonie), soziologische (Verherrlichung der Meritokratie durch die gebildeten Klassen), anthropologische (Auflösung vielfältiger Lebensformen in der berechnenden, marktwirtschaftlichen Logik), geografische (Metropole gegen Peripherie) und kulturelle (gesellschaftliche Kämpfe gegen soziale Kämpfe).
All diese unterschiedlichen Erklärungsansätze fügen sich nur dann zu einem kohärenten Bild zusammen, wenn man zusätzlich zwei selten erwähnte Ursachen berücksichtigt: einerseits das Ende der „sowjetischen Bedrohung“, die auf die Führer der „freien“, kapitalistischen Welt früher eine ausgleichende Wirkung hatte; und andererseits die Verschlechterung der Beziehung zwischen Unterklassen und institutioneller Politik.
Der Ökonom Thomas Piketty ist zwar ein entschiedener Gegner des revolutionären Marxismus, aber auch er erkennt an, dass „die Verringerung der Ungleichheit im 20. Jahrhundert viel mit der Existenz eines kommunistischen Gegenmodells zu tun hatte.“ Durch den Druck auf die Eigentümer-Elite in den kapitalistischen Ländern habe es „das Kräfteverhältnis stark beeinflusst und ein Steuer-, Sozial- und Sozialversicherungssystem entstehen lassen, das man ohne dieses Gegenmodell wohl kaum durchgesetzt hätte.“9 Es mag heute seltsam erscheinen, aber vor allem für den engagierten Teil der westlichen Arbeiterklasse symbolisierte die Sowjetunion jahrzehntelang die konkrete Möglichkeit einer anderen Gegenwart, mit anderen Worten: eine Hoffnung.
Es gibt keine Politik ohne Glauben an die Zukunft. Die Verbindung von Wunsch, Illusion und Hoffnung ist in den 1980er Jahren geschwunden, als die Regierungslinken zu Liberalen wurden und damit die Industriebastionen zerstörten und die dortige Arbeiterschaft, die seit den 1930er Jahren sehr einflussreich war, ins Abseits katapultierte.10 Die „Entpolitisierung“, die Kommentatoren und Umfrageinstitute bei sozial schwachen Bevölkerungsgruppen registrieren, ist nur ein Name für die Weigerung, sich an einem Spiel zu beteiligen, bei dem man nichts mehr zu gewinnen hat.
Occupy war gestern
Der Rückzug der einen festigt das Monopol der anderen. Je weiter der Anteil der Hochschulabsolvent:innen steigt (in Europa und den USA nach dem Krieg weniger als 5 Prozent, heute mehr als ein Drittel), desto größer wird die kulturelle Hegemonie dieser Bevölkerungsgruppe und ihr Einfluss als Wählerschaft. Um politisch zu dominieren, ist es für sie nicht mehr so wichtig, Bündnisse mit anderen Gruppen zu schmieden, deren Prioritäten sie dann auch berücksichtigen müssten.
In den 1950er und 1960er Jahren wählten die Reichen und Gebildeten rechts, während die Armen und weniger Gebildeten links wählten. Das hat sich geändert: Eine Person mit Universitätsabschluss tendiert bei der Wahlentscheidung eher nach links. Wer weder ein Diplom hat noch ein Spezialist ist und sich deshalb verachtet fühlt, ist geneigt, das Gegenteil zu wählen.11 Auch überall in Europa begegnet man inzwischen dem „US-amerikanischen Modell“: Reiche, intellektuelle Städte wie New York oder San Francisco wählen demokratisch, ein armer, ländlicher Staat wie West Virginia oder Mississippi stimmt für die Republikaner.
Anders als vor 30 oder 40 Jahren können die Parteien der gemäßigten Linken – ob sie sich Sozialisten, Labour, Demokraten oder Grüne nennen – jetzt auf Wahlsiege hoffen, auch wenn sie die Forderungen der Wähler:innen aus den Unterklassen ignorieren – zumal sich diese kaum an den Wahlen beteiligen. Also können sie ungestört einen kulturellen und gesellschaftlichen Liberalismus vertreten, der sich vor allem an das aufgeklärte Bürgertum richtet. „Die Arbeiter verlieren? Das macht nichts!“, hatte Hollande einst verkündet. Und der New Yorker Senator Chuck Schumer formulierte es im Juli 2016 so: „Für jeden demokratischen Arbeiter, den wir in Westpennsylvania verlieren, gewinnen wir zwei gemäßigte Republikaner in den Vororten von Philadelphia“.12 Drei Monate später gewann Donald Trump Pennsylvania und damit die Wahl.
Auch Dominique Strauss-Kahn hatte empfohlen, die französischen Sozialisten sollten auf die Wählerschaft aus den Unterklassen verzichten und sich „absolut vorrangig um das kümmern, was in der Mittelschicht unseres Landes geschieht“. Diesen Ratschlag gab Strauss-Kahn kurz vor der Präsidentschaftswahl von 2002, bei der sein Kandidat verlor, und erklärte ihn damals so: „Die Angehörigen der Mittelschicht, die sich zum übergroßen Teil aus gescheiten, gebildeten und informierten Arbeitnehmern zusammensetzt, sind das Gerüst unserer Gesellschaft und sichern ihre Stabilität.“ Das sei nicht der Fall bei der „Gruppe der sozial am stärksten Benachteiligten“, so Strauss-Kahn, diese wählten „meistens gar nicht“ und ihr „Zorn entlädt sich manchmal in Gewalt“.13
Vor 20 Jahren siegten die Sozialisten über die Konservativen bei den Kommunalwahlen in Paris, verloren aber 20 andere Städte. Einer ihrer Köpfe, Henri Emmanuelli, veröffentlichte damals einen Artikel mit dem ironischen Titel: „Die Linke – zu welchem Quadratmeterpreis?“14 Darin schrieb er: „Inzwischen scheint der Einfluss der linken Parteien dem Quadratmeterpreis zu folgen, dabei war es traditionell eher umgekehrt.“ 1983 und 1989 hatte der Konservative Jacques Chirac noch in allen 20 Arrondissements der Hauptstadt gewonnen. Ab 2001 folgten ein Sozialist und eine Sozialistin, in deren Amtszeit sich der Quadratmeterpreis verdreifacht hat.
Die Rechtsextremen, die bei der Präsidentschaftswahl 1988 in Paris, ähnlich wie im Landesdurchschnitt, 13,38 Prozent bekommen hatten, holten 2017 in der Hauptstadt nur noch 4,99 Prozent, obwohl Marine Le Pen landesweit vor allem dank der Stimmen der Arbeiter und Angestellten auf 21,3 Prozent kam. Angesichts einer solchen soziologischen Umkehrung ist es nicht verwunderlich, dass die oberen Klassen und Hochschulabsolvent:innen bei der Linken den Ton angeben und ihre strategischen Prioritäten festlegen.
Dabei hat nicht jeder unbedingt die gleichen Ziele; und das gilt auch für die Wähler:innen ein und derselben Partei. In den USA sollten 2017 Arbeiter, die für die Demokraten gestimmt hatten, angeben, welche Themen für sie besonders wichtig waren. Sie nannten Gesundheitsversorgung, Wirtschaft, Sozialversicherung und Medicare. Die fünf wichtigsten Themen unter progressiven Hochschulabsolvent:innen, genauer der „kreativen Kreise“ aus Journalist:innen, Künstler:innen, Lehrer:innen, Marketingprofis, Abgeordneten, Professor:innen, Leser:innen der New York Times, Blogger:innen oder Hörer:innen der öffentlichen Rundfunksender, waren, in dieser Reihenfolge: Umwelt, Klimawandel, Gesundheitsversorgung, Bildung, Armut.15
Diese Unterschiede sind nicht gleichbedeutend mit der Diskrepanz zwischen Gemäßigten und Radikalen. 2019 erlitt die britische Labour Party eine krachende Niederlage, als ihr Vorsitzender Jeremy Corbyn unter dem doppelten Druck der Blair-treuen Abgeordneten, die ihn hassten, und der radikalen Studierenden, die ihn unterstützten, für den Fall seines Wahlsiegs ein zweites Brexit-Referendum ankündigte. Für den Austritt aus der EU, den die gebildete Mittelklasse, Gemäßigte ebenso wie Radikale, heftig ablehnte, hatten jedoch gerade Wahlkreise mit sehr vielen Arbeitern gestimmt. Wegen Corbyns Entscheidung für Europa gingen Dutzende Wahlkreise an die Tories. Die Lehre ist eindeutig: Wenn die Linke die Wähler:innen zurückgewinnen will, die sie verloren hat, sollte sie besser nicht die Themen in den Vordergrund rücken, die diese Wählerschicht am meisten verärgern.
In schwierigen Zeiten wächst die Sehnsucht nach guten Nachrichten. Seit Beginn der Coronakrise hat die Mobilisierung einer offensiven Linken nachgelassen; der Rückzug auf sich selbst nimmt ebenso zu wie die Sehnsucht nach der „Welt von früher“ und die Fokussierung der öffentlichen Debatte auf die identitären Obsessionen der Rechtsextremen. Das alles gehört zu einer Politik der Angst, und wenn die Linke ihr nachgäbe, könnte sie nur noch die Errungenschaften der Vergangenheit verteidigen oder ein zusammengestückeltes Programm vorschlagen, um das Schlimmste zu verhindern.
Unter diesen Voraussetzungen wird der Damm gegen rechts dann meist auf dem Fundament der gemäßigten, zaghaften Vorschläge aufgebaut, die am wenigsten Gefahr laufen, am Ende irgendetwas an der existierenden Ordnung zu ändern: Hollande und Macron eher als Mélenchon 2012 und 2017, Clinton und Biden eher als Sanders 2016 und 2020. Doch damit nimmt man die Gefahr in Kauf, dass das Wasser beim nächsten Mal noch höher steigt.
Architekten des Wirtschaftsliberalismus wie Friedrich Hayek, die genug von den Verteidigungskämpfen gegen den Nachkriegssozialismus hatten, wählten einen anderen Weg. Sie forderten ihre Anhänger zu einem „intellektuellen Abenteuer“, zu „mutigem Handeln“ und „wahrem Radikalismus“ auf. Heute gilt dieser Rat den Linken: Die gewissenhafte Einhaltung der ökonomischen und politischen Spielregeln, die seit 30 Jahren von ihren Gegnern festgelegt werden, würden sie sicher in die nächste Niederlage führen.
Der dreifache Notstand – ökologisch, sozial und demokratisch – verlangt vielmehr, dass wir dem heute herrschenden „liberalen Radikalismus“, dessen Fortsetzung am Ende die Gesellschaft zerstören und das Ende der Menschheit herbeiführen würde, eine andere Radikalität entgegensetzen. Diesmal mit der Gewissheit, dass eine intellektuelle und meritokratische Linke weder egalitär noch populär und gewiss nicht siegreich sein kann.
Sollte der neue chilenische Präsident Gabriel Boric seinen Worten Taten folgen lassen und aus seinem Land das „Grab“ des Neoliberalismus machen, könnte er uns als Vorbild dienen. Dass es ein steiniger Weg sein wird, ist stark untertrieben. Als Noam Chomsky eines Tages nach seinem unerschütterlichen Optimismus gefragt wurde, antwortete er: „Du hast die Wahl. Du kannst sagen: Ich bin Pessimist, das wird alles nichts, ich verzichte und garantiere damit, dass das Schlimmste kommt. Oder du orientierst dich an den Hoffnungsschimmern und den vorhandenen Möglichkeiten und sagst, dass wir vielleicht eine bessere Welt errichten werden. Eigentlich hast du gar keine Wahl.“
1 „Questions politiques“, France Inter, 21. März 2021.
2 Jean-Pierre Chevènement, „Qui veut risquer sa vie la sauvera“, Paris (Robert Laffont) 2020.
3 Siehe Niels Kadritzke, „Tsipras und die Realpolitik“, LMd, November 2015.
4 Interview in L’Humanité, 8. November 2019, Nachabdruck am 24. März 2020, kurz nach seinem Tod.
6 Gerald Darmanin, Le Journal du dimanche, 7. April 2019.
8 „Frédéric Lordon: „Rouler sur le capital“, Ballast, 21. November 2018
9 Vortrag bei den „Amis de l’Huma“, 31. Januar 2020.
12 „The democrats' risky pursuit of suburban republicans“, The new Republic, 19. Dezember 2017.
13 Dominique Strauss-Kahn, „La Flamme et la Cendre“, Paris (Grasset) 2002.
14 Libération, Paris, 27. März 2001
Aus dem Französischen von Claudia Steinitz




