Geliebte Schulden
Warum der Finanzmarkt nach Staatsanleihen giert
von Frédéric Lemaire
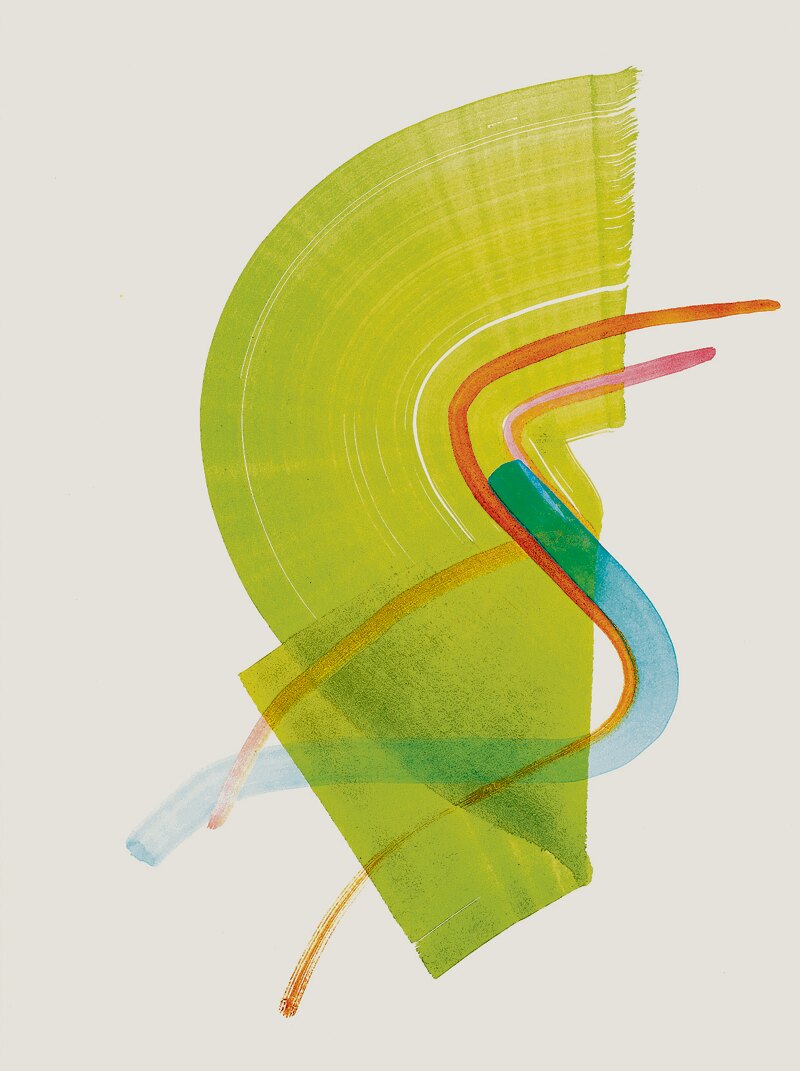
In den letzten Jahren ist es großen Ländern wie Frankreich und Deutschland gelungen, Schulden zu negativen Zinssätzen aufzunehmen. In anderen Worten, sie verdienen Geld, indem sie es sich leihen, und – was noch überraschender ist – die Anleger sind bereit, Geld zu verlieren, um es ihnen zu leihen. Wie lässt sich eine so verrückte Situation erklären?
Staatsanleihen sind zu einer wichtigen Ressource für die Finanzmärkte geworden. Schon bevor es negative Zinssätze gab, trug die Staatsverschuldung stark zur Entwicklung der Märkte bei. Das ist besser zu verstehen, wenn man die Sache andersherum betrachtet: Die Staatsverschuldung ist weniger eine Gunst, die großzügige Gläubiger den mittellosen Staaten gewähren, als vielmehr das „unentbehrliche Grundnahrungsmittel für die Märkte“.1
In den 1970er und 1980er Jahren diente die Staatsverschuldung zunächst einmal dazu, überschüssige Ersparnisse aufzufangen, die damals zur Bedrohung für die Weltwirtschaft wurden. Die erdölexportierenden Länder hatten Riesenmengen an Dollars angehäuft, die sie nicht loswerden konnten. Als kleine Volkswirtschaften waren sie außerstande, sie in Form von Investitionen oder Importen zu absorbieren, und ihre Bankensysteme waren nicht weit genug entwickelt, um das Geld mittels verzinslicher Kredite zu vermehren. Durch die Inflation in den USA, die während der beiden Ölkrisen (1973 und 1979) zweistellig ausfiel, wurde der Wert dieser Dollarbestände weiter verringert. Damals erzielten viele ölimportierende Länder dank rapide steigender Preise hohe Handelsdefizite.
Dies war ein Glücksfall für die auf dem Eurodollarmarkt tätige Offshore-Finanzindustrie, also jene US-amerikanischen und europäischen Großbanken, die Geschäfte mit internationalen Dollareinlagen und -krediten in London machten, wo sie die Regularien der US-Währungshüter umgehen konnten; etwa die noch aus der New-Deal-Ära stammende „Regulation Q“, mit der die US-Notenbank Federal Reserve den in den USA tätigen Banken niedrige oder sogar negative Realzinsen aufzwang.
Der Eurodollarmarkt bot überdies die Möglichkeit, die Besteuerung von Zinserträgen und Auslandsanleihen in den USA zu umgehen. Mit dem Segen der britischen Notenbank und der Duldung der Federal Reserve nutzten die US-Banken den Eurodollarmarkt, um Anlagemöglichkeiten in der ganzen Welt zu erschließen und höhere Renditen zu bieten. Zu ihren Kunden gehörten die Ölmonarchien, aber auch reiche US-Anleger, die sich mit den minimalen oder Realzinsen im eigenen Land nicht begnügen wollten.
Um die monetären Überschüsse der Weltwirtschaft anzulegen, bot sich die Staatsverschuldung nachgerade an. Auf die setzten insbesondere unterentwickelte Länder2 , um eigene Industrien aufzubauen oder einfach gierige autoritäre Regime zu päppeln. Die Banker konnten diese Regierungen sehr einfach dazu bringen, der Verlockung des leichten Geldes nachzugeben.
Zwischen 1970 und 1980 stieg das Volumen der Kredite, die internationale Großbanken an die Entwicklungsländer vergeben hatten, von 3,8 auf 128 Milliarden US-Dollar. Es war der Beginn der großen Schuldenkrisen der 1980er Jahre. 2005 hat Ben Bernanke, der kurz darauf Chef der Federal Reserve wurde, das Phänomen der Überschuldung – allerdings am Beispiel der USA selbst – ganz anders erklärt: Es sei weniger die Folge mangelnder Haushaltsdisziplin als vielmehr überschüssiger privater Ersparnisse, die nach besseren Anlagemöglichkeiten suchen.4

Schmiermittel für das Geschäft der großen Banken
Die Staatsverschuldung war der ideale Schwamm, um all die Ersparnisse aufzusaugen. Sie spielte eine entscheidende Rolle bei der in den 1980er Jahren einsetzenden rasanten Expansion der Finanzmärkte. Die westlichen Staaten konnten sich also „leichtes Geld“ beschaffen, indem sie Staatsanleihen ausgaben, die auf den Finanzmärkten gehandelt wurden. Auch reiche Privatpersonen und Investoren profitierten von diesen Finanzprodukten, womit zugleich die Finanzialisierung der Volkswirtschaften vorangetrieben wurde.
Zur selben Zeit kamen Steuersenkungen für die reichsten Haushalte in Mode, die angeblich Investitionen ankurbeln sollten. Das lief auf einen Umverteilungsprozess hinaus, bei dem die Reichen gleich doppelt profitierten: von den Steuergeschenken und von den Zinsen der Staatspapiere: „Dank der geringeren Steuerlast können sie höhere Ersparnisse bilden, die sie an den Staat in Form von Darlehen weiterreichen. Dabei hatte der Staat durch die Steuersenkungen selbst dafür gesorgt, dass er Schulden machen musste.“5
Die erste französische Staatsanleihe wurde 1985 begeben. Seitdem hat das Volumen dieser handelbaren Schuldtitel auf den Märkten enorm zugenommen. Die Staatsverschuldung von 1985 in Höhe von umgerechnet 233 Milliarden Euro entsprach 30,7 Prozent des damaligen Bruttoinlandsprodukts (BIP). 2020 stand sie bei 2,65 Billionen Euro (größtenteils Anleihen) oder 116,4 Prozent des BIPs.
Dieser stete Zustrom an öffentlichen Schuldtiteln war für die Investoren ein gefundenes Fressen. Da niemand mit der Zahlungsunfähigkeit von Ländern wie Frankreich oder Deutschland rechnet, gelten deren Schuldtitel (Staatsobligationen) als äußerst sicher. Diese Papiere werden oft erworben, um einen Ausgleich für wesentlich riskantere Investments etwa in Aktien zu schaffen. Deshalb unterliegen das Wachstum der Aktienmärkte und der Anstieg der Staatsverschuldung derselben Dynamik: „Wer in Aktien investiert, erwirbt immer auch einen gewissen Teil Staatsanleihen“, schreibt der Ökonom Bruno Tinel.6
Seit den 2000er Jahren wirkte die Staatsverschuldung als idealer Treibstoff für die Finanzmärkte. Im Bankensektor setzte sich ein „markt“-basiertes Geschäftsmodell durch, das sich deutlich von seinem kreditbasierten Vorläufer unterscheidet. Das erlaubte es den Banken, ihre Aktivitäten auf den Wertpapiermärkten massiv auszuweiten und ihre Gewinne kräftig zu steigern.
Bei diesem marktbasierten Geschäftsmodell sind die Banken in hohem Maße auf kurzfristige Kredite angewiesen, um ihre Aktiva – Anleihen und Aktien oder andere Anlagen – zu refinanzieren. Die für den Erwerb von Wertpapieren aufgenommenen Schulden werden typischerweise täglich erneuert und dienen meist der Umstrukturierung vorheriger Schulden, wobei niedrige Zinssätze für die Rentabilität der Banken entscheidend sind.
Deshalb tätigen die Institute häufig sogenannte Rückkaufvereinbarungen oder Repogeschäfte (repurchase agreements): Sie verpfänden ihren Gläubigern Wertpapiere, um dafür sehr kurzfristige Kredite mit besonders niedrigeren Zinsen zu erhalten. Die verpfändeten Sicherheiten verringern die Risiko und damit den Zinssatz. Im Dezember 2020 bezogen sich 92 Prozent aller Repogeschäfte auf dem europäischen Markt auf Staatsobligationen.7
Diese Art von Geschäften hat die verfügbare Liquidität seit den 2000er Jahren stark erhöht. Die Staatsverschuldung wurde zum unverzichtbaren Schmiermittel für die Aktivitäten der großen Banken, die damit ihre Umsätze steigern und ihre Bilanzen aufblähen wollten. Von diesem Geschäftsmodell schienen alle Akteure zu profitieren: die langfristigen Anleger, die ihre Bestände an Staatsanleihen aufstockten, die Banken, die ihre Refinanzierungskosten senkten, und die Regierungen, deren Staatsobligationen immer stärker nachgefragt wurden.
Allerdings litten die Banken bald unter einem Mangel an „colletorals“ – also an als „Sicherheit“ hinterlegbaren Papieren der reichen Länder. Um diese Lücke zu füllen, begannen die Finanzinstitute, zunächst in den USA, mit der Verbriefung von privaten Schulden. Durch die Bündelung vieler, oftmals minderwertiger (subprime) Immobiliendarlehen sollten Wertpapiere von ausreichender Qualität entstehen, die als colletorals dienen konnten. Diese riskanten Praktiken führten zu der schweren Immobilien- und Finanzkrise, die im September 2008 in der Pleite der Bank Lehman Brothers gipfelte.
In Europa waren insbesondere deutsche Anleihen, die als Sicherheiten zugelassen waren, nicht in ausreichender Menge verfügbar, um die Nachfrage zu decken. 2002 verabschiedete die EU daher eine Richtlinie über Sicherheiten, der zufolge die Staatsschulden aller Länder der Eurozone bei Repogeschäften als gleichwertig gelten sollten. Mit Unterstützung der Kommission und der Europäischen Zentralbank (EZB) wuchs der von den Großbanken dominierte europäische Repomarkt im Jahr 2008 auf ein Volumen von 6 Billionen Euro.8
Die damalige globale Finanzkrise hat jedoch die Gefahren des marktbasierten Bankenmodells überdeutlich gemacht – und besonders die Gefahr einer Massenpanik aufgrund der Verflechtung und gegenseitige Abhängigkeit der Finanzakteure, die nicht zuletzt aus Repogeschäften resultierte. Die Krise ließ auch andere Quellen für Sicherheiten versiegen: etwa Verbriefungsprodukte oder die Anleihen ökonomisch schwächerer Staaten, deren Qualität pauschal angezweifelt wurde.
Die Grexit-Debatte verstärkte die Unsicherheit und führte dazu, dass die Finanzakteure in „sichere Häfen“, also in die Staatsanleihen der großen Industrieländer flüchteten. Dies hatte zweierlei Konsequenzen: Die reichsten Länder profitierten von drastisch gesenkten Kreditkosten, die anderen Länder dagegen mussten höhere Zinssätze auf ihre Staatsanleihen zahlen, die zudem ihren Status als akzeptable Sicherheiten einbüßten.
Doch die „Flucht in die Qualität“ ist nicht der einzige Faktor, der die aktuell niedrigen oder negativen Zinssätze für deutsche oder französische Schuldtitel erklärt. Nach den Finanzkrisen der letzten Jahre sind diese Wertpapiere nach wie vor eine unverzichtbare Grundlage für Repogeschäfte. Zudem bestimmen die neuen Vorschriften der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, dass die Banken einen bestimmten Anteil an „hochwertigen“ Vermögenswerten, also hauptsächlich Staatsanleihen halten müssen. Diese spielen auch eine wichtige Rolle bei den Interventionen der Europäischen Zentralbank zur Bereitstellung von Liquidität für den Finanzsektor, etwa beim direkten Ankauf von Staatsanleihen auf dem Markt. Dieses quantitative easing dient der Konjunkturbelebung, wenn die EZB die Zinsen nicht mehr weiter senken kann.
All dies demonstriert die unverzichtbare Rolle, die öffentliche Anleihen aufgrund ihrer Sicherheit, Liquidität und Markttiefe für das globale Finanzwesen nach der Krise von 2008 spielen. Und es macht deutlich, warum die Staatsverschuldung seit vier Jahrzehnten für Gläubiger und Investoren gleichermaßen wichtig ist. Es zeigt allerdings auch, dass der vorherrschende Diskurs über Schulden dringend überdacht werden muss.
Das führt zu zwei Fragen: Sind es nicht die Märkte selbst, die nach Staatsschulden geradezu süchtig sind? Und ist die Hauptursache für die wachsende Staatsverschuldung nicht eher der unaufhaltsame Aufstieg des Finanzsektors – und keineswegs die mangelnde Haushaltsdisziplin der Regierungen? Kurzum: Was uns die alarmistischen Kommentare über die „fatale“ Verschuldung und den gefährlichen „Vertrauensverlust“ der Gläubiger einreden wollen, hat nichts mit den tatsächlichen Kräfteverhältnissen zu tun.
7 Bruno Tinel, „Dette publique: sortir du catastrophisme“, Paris (Raisons d'agir) 2016.
Aus dem Französischen von Nicola Liebert
Frédéric Lemaire ist Ökonom.




