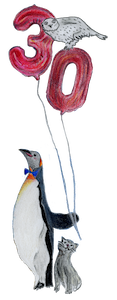Dreierlei Gedenken
ZEUGEN von menschlichen Handlungen, die aus zweiter Hand vermittelt werden, reagieren auf ganz unterschiedliche Weise. Das gilt auch für die Besucher von Museen, die von den Schreckenstaten der Vergangenheit handeln.
Das Holocaust-Museum in Washington wurde 1993 eröffnet, das Apartheid-Museum in Johannesburg und das Jüdische Museum in Berlin im Jahr 2001. Obwohl niemand die Notwendigkeit solcher Institutionen anzweifelt, die uns mit einer für viele noch lebendigen Erinnerung konfrontieren, wurden gegen alle drei Museen kritische Einwände vorgebracht. Sie betreffen sowohl ihre Gemeinsamkeiten wie ihre Besonderheiten. Wir Besucher sind Betrachter aus zeitlicher und räumlicher Distanz – was wir Perspektive nennen.
Um die Kritik an den drei Museen zu würdigen, müssen wir uns, glaube ich, zunächst darüber klar werden, weshalb die Bedeutung des Worts „Holocaust“ so diffus geworden ist, dass sie mit der wortgenauen Definition, die auf die Intention des Genozids abhebt, nur noch wenig zu tun hat. Heute wird jedes Massaker, an dem politische oder ethnische Gruppen beteiligt sind, als Holocaust bezeichnet, auch wenn die Gewaltanwendung darauf zielt, Macht über andere zu gewinnen, und nicht etwa, ihre Existenz auszulöschen.

Damit stellt sich die Frage, ob die alte, enge Definition überhaupt richtig war. Vielleicht ist es hilfreich, die Unterschiede zwischen den drei Museen zu untersuchen. Das Museum in Washington zeigt den Holocaust, es thematisiert die Absicht, alle Juden in Deutschland und in den von Deutschen besetzten Ländern umzubringen. Die Museen in Berlin und Johannesburg verfolgen, wie das Projekt in Washington, auf unterschiedliche, wenn auch verwandte Weise ein doppeltes Ziel: Das Jüdische Museum präsentiert zum einen in chronologischer Darstellung die politische und kulturelle Geschichte der Juden in Deutschland bis zum Beginn der Vernichtungspolitik der Nazis. Zum anderen stellt es das Schicksal der Juden in der NS-Zeit dar. Das Apartheid-Museum veranschaulicht zum einen den Hintergrund des vorkolonialen Afrika, die Zeit der ersten weißen Besiedlung, die vielfältigen Folgen von Ausbeutung, Industrialisierung und Verlust von Grund und Boden für das Schicksal der schwarzen Bevölkerung. Zum anderen konzentriert es sich auf die politische Unterdrückung der Schwarzen und auf den Kampf, der ihnen am Ende die Freiheit brachte.
Damit wird deutlich, dass sich heute wohl ein erweiterter Begriff von „Holocaust“ durchgesetzt hat, der alle Versuche umfasst, das Recht eines Volkes auf ein Leben ohne Diskriminierung und Unterdrückung abzutöten, unabhängig von den angewandten Methoden.
Beim Holocaust-Museum in Washington wird immer wieder kritisch angemahnt, es solle das Schicksal aller Menschen darstellen, die unter den Nazis gelitten haben: der 6 Millionen Juden ebenso wie der 5 Millionen Menschen, die Widerstand gegen die Nazis geleistet haben, der Homosexuellen, der Zigeuner und anderer Opfergruppen. Dagegen steht das Argument, der Holocaust an den Juden, also ihre offen propagierte Vernichtung durch die Nazis, sei nur die Zuspitzung der singulären, zweitausendjährigen Geschichte der Judenverfolgung. Wer in Washington die Schuhe der in den Gaskammern umgebrachten Opfer sieht, die den Vernichtungsgeruch erahnen lassen, entwickelt vielleicht ein abgründiges Verständnis dafür, was Genozid an sich heißt, ohne an eine bestimmte Gruppe zu denken.
Das Eindrucksvollste am Jüdischen Museum in Berlin ist für mich die atemberaubende Architektur von Daniel Libeskind – allein sie schon eine Provokation, die starke Empfindungen auslöst: von Verstörung und Eingeschlossensein, von Unterdrückung durch Mauern, von physischer und ideologischer Verfolgung. 18 Monate lang blieb das Museum nach seiner Eröffnung leer. Manche meinen, man hätte es so belassen sollen: Der Bau selbst sei die Aussage. Ich war da, nachdem man das Museum mit Exponaten gefüllt hatte, die das Leben, die Kultur und die Glaubensinhalte der deutschen Juden seit dem Mittelalter und der Zeit davor vergegenwärtigen wollen. Aber es hat harte Kritik gegeben: Das Museum habe eine „Disneyland-Ästhetik“ geschaffen, es sei „ein gigantisches Missverständnis“, weil es die Tatsachen simplifiziere.
Und doch geht es hier eindeutig darum, unbequeme Tatsachen ehrlich zu präsentieren: die Assimilationsversuche der deutschen Juden im 19. und 20. Jahrhundert wie auch ihre bemerkenswerten Beiträge zum kulturellen Leben in Deutschland, die dann aufgrund der Verfolgung durch die Nazis versiegten (davon haben dank der vielen Emigranten vor allem die Vereinigten Staaten profitiert).
In der Ausstellung sieht man einen deutsch-jüdischen Weihnachtsbaum, sieht man Becken und Wasserkanne aus Silber, aus dem Besitz einer jüdischen Familie, die verzweifelt versuchte, ihr bevorstehendes Schicksal abzuwehren, indem sie einige ihrer Söhne christlich taufen ließ, während die anderen ihren jüdischen Glauben behielten. Die Fotografien und schriftlichen Dokumente über den Holocaust sind deutlich persönlicher als das Material in Washington. Dort fordern einige Kritiker, man müsse die Zeugnisse zum Andenken der Toten um eine Darstellung des Lebens von deutschen Juden in der Diaspora ergänzen. Eine solche Erweiterung ist offenbar geplant.
Die Initiative für das Apartheid-Museum in Johannesburg ist aus einem Deal über ein Spielcasino hervorgegangen. Die Bewerber für den Casinobetrieb erhielten die Lizenz nur unter der Auflage, dass sie auf ihrem Gelände auch ein Social-responsibility-Projekt verwirklichen. Die Tatsache, dass dieses Museum gleich neben einer gigantischen Achterbahn steht, ist für Menschen wie mich eine Beleidigung, weil sie in unseren Augen die Würde des südafrikanischen Freiheitskampfes verletzt. Tatsache ist aber, dass wir, das heißt unsere von der Mehrheit gewählte ANC-Regierung und die politischen Bewegungen, denen wir angehören, ein eigenes Apartheid-Museum zwar diskutiert, aber nie zustande gebracht haben.
Kehrt man dem Casinokomplex den Rücken und betrachtet das von südafrikanischen Architekten entworfene Museumsgebäude, ist der Eindruck ähnlich stark wie beim Libeskind-Bau, an den man sogar erinnert wird. Damit stellt sich ein angemessener Bezug zwischen zwei Varianten von krudem Rassismus her: dem Apartheid- und dem Nazi-System.
Am Eingang kauft jeder Besucher eine Plastikkarte. Bei Weißen sagt die Karte, dass man schwarz sei, Schwarze werden als weiß etikettiert. Man betrifft das Gebäude durch zwei nebeneinander liegende, aber getrennte Eingangsbereiche. Auf diese Weise erfahren die Schwarzen das Privileg, Weiße zu sein, und die Weißen erfahren die Diskriminierung als Schwarze.
Auf dem Gang durch das Museum kehrt dieses verstörende Grundmuster immer wieder: in den Dokumenten, im Wortschatz der Diskriminierung, in der ganzen Grobheit und Grausamkeit des Systems. Aber das wichtigste Thema ist letztlich doch der Widerstand, also die Freiheitsbewegung und ihre Helden. Dabei wird von vielen Seiten kritisiert, dass bestimmte Personen, bestimmte Themen nicht vorkommen. Manche bemängeln, das Museum konzentriere sich zu sehr auf die Rolle des African National Congress (ANC) bei der Befreiung des Landes, obwohl der ANC mit dem South African Indian Congress und der South African Communist Party wichtige Bündnispartner gehabt habe. Progressive weiße Kräfte fühlen sich übergangen, der Pan African Congress findet seine Rolle nicht ausreichend gewürdigt. Und in dem TV-Clip, der in dem Museum gezeigt wird, fehlen viele Gesichter und Namen und Taten, oder sie werden nur flüchtig gestreift.
Aber was will man mit solchen Museen erreichen? Die allgemeine Annahme lautet, dass wir uns, wenn das unmenschliche System der Vergangenheit uns vor Augen geführt wird, nie mehr an etwas beteiligen werden, was uns an das Gesehene erinnert. Es soll nie wieder geschehen.
Aber während wir uns mit der Vergangenheit konfrontieren, geschehen in unserer globalisierten Welt erneut unmenschliche Dinge: „ethnische Säuberungen“ in Bosnien, Genozid in Ruanda, blutige Konflikte zwischen Christen und Muslimen in Elfenbeinküste, Palästinenser sterben durch israelische Kugeln, Israelis durch palästinensische Selbstmordattentäter.
Als der Schriftsteller Philip Gouravitch 1995 das Holocaust-Museum in Washington besuchte, meinte ein Besucher zu ihm: „Wir wissen, welche grausamen Dinge in diesem Augenblick in der Welt geschehen. Und was tun wir? Wir sitzen in einem Museum.“
Da sitzen wir bis heute.
deutsch von Niels Kadritzke
* Südafrikanische Schriftstellerin und Literaturnobelpreisträgerin, die sich Zeit ihres Lebens für die Gleichberechtigung der Schwarzen eingesetzt hat und deshalb im Apartheid-Staat als Persona non grata galt.