Der Drache schnurrt
Als Chinas Wirtschaft wuchs und die Diplomaten in die Charmeoffensive gingen
von Martine Bulard
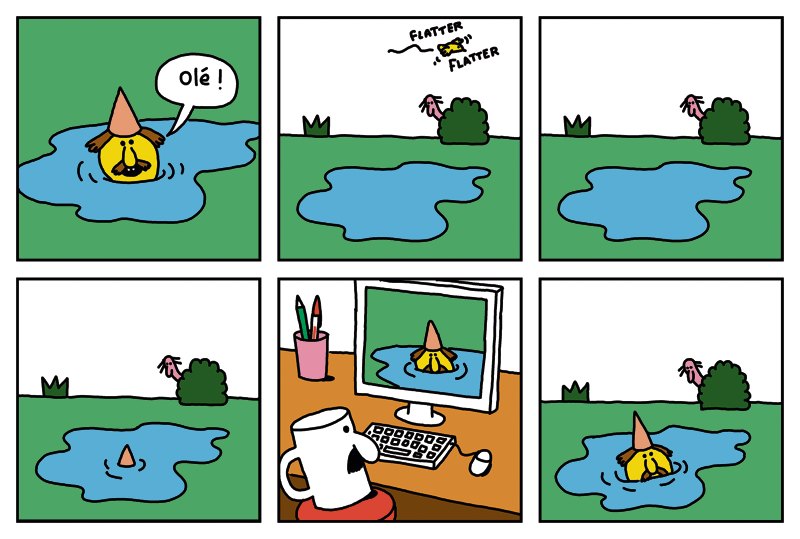
In Peking und Schanghai, in Regierungskreisen, in den Zirkeln renommierter Thinktanks und im universitären Milieu dreht sich derzeit alles um ein Wort, wenn von den geopolitischen Strategien Chinas die Rede ist: Stabilität. Doch was damit gemeint ist, erschließt sich erst in der Gesamtschau auf dieses Land im permanenten Wandel.
Nie zuvor haben die Staatsführer der Volksrepublik so häufig das Ausland bereist wie heute. Auch die Universitäten verhalten sich ausgesprochen weltoffen und bieten neuerdings sogar Politikberatung an. Das gilt auch für Institutionen, die von ausländischen Geldgebern finanziert werden, wie etwa das „Zentrum für internationale Studien“, das der renommierten Beida-Universität in Peking angegliedert ist.
Die Einrichtung residiert in drei ultramodernen Gebäuden: Das Hauptgebäude wurde von einem italienischen Unternehmen gesponsert, die beiden Seitenflügel wurden von zwei verschiedenen Firmen aus Hongkong finanziert. Drei Architekten haben die Entwürfe geliefert, und dennoch fügen sich die Gebäude harmonisch in das historische Ensemble. Die architektonische Botschaft lautet: Öffnung bedeutet nicht etwa Selbstaufgabe, und Stabilität ist keineswegs gleichbedeutend mit Stillstand.
Gegenüber dem Feng-Lian-Turm, wo sich eine Luxusboutique an die andere reiht, liegt das Büro von Kong Quan, Sprecher des Außenministeriums: „China ist vor allem auf ein stabiles, der Entwicklung förderliches Umfeld bedacht“, erklärt er. Hunderte Kilometer entfernt, im Herzen der berühmten Fuda-Universität von Schanghai, liegt das Zentrum für Amerikastudien, dessen nagelneue Räumlichkeiten zum Teil von der US-Agentur für internationale Entwicklung (USAID) finanziert wurden. Auch Professor Shen Dingli, ein prominenter Experte für Nuklearfragen, lenkt das Gespräch bald auf das allfällige Thema. Nichts fürchte er so sehr wie eine stets mögliche Destabilisierung auf der koreanischen Halbinsel oder im Nahen Osten, von wo China fast die Hälfte seiner Erdöleinfuhren bezieht.
Dingli erklärt uns, was manche Beobachter als Status-quo-Diplomatie bezeichnen. Für Peking sei die etablierte Ordnung, selbst die nicht so willkommene von Amerikas Gnaden, allemal besser als chaotische Zustände, die das Wirtschaftswachstum und die internationalen Ambitionen Chinas nur behindern würden. Wachstum sei die Grundlage des innenpolitischen Sozialkontrakts, der letzten Endes die Fortdauer des Regimes sichere. Und die internationalen Projekte sollen China erneut „zu dem Rang verhelfen, der ihm auf der internationalen Bühne gebührt“, wie es Kong Quan formuliert.
Entgegen einer weit verbreiteten Ansicht folgt die chinesische Diplomatie nicht nur dem Prinzip, sich den Säckel mit Rohstoffen und Getreiden zu füllen. Zwar haben auch die internationalen Beziehungen ihren Beitrag zur Energie- und Nahrungsmittelversorgung des Landes zu leisten. Aber die Wirtschaftspolitik soll noch eine andere Funktion erfüllen: In Chinas Selbstbild als Regional- und Weltmacht gilt eine erfolgreiche Ökonomie als friedenssichernde Maßnahme, ohne die kein Land auskomme, will es international anerkannt werden. Oft wird man hier an die „Geschichte der letzten 500 Jahre“ erinnert, deren Lehre heißt: Ohne starke Wirtschaft kann sich keine Nation Gehör verschaffen.
Drei Ereignisse der jüngeren Vergangenheit spielen in den Überlegungen eine entscheidende Rolle: erstens die politischen Unruhen vom Tiananmenplatz vor 16 Jahren, die in der Presse nach wie vor zu den Tabuthemen zählen. Das liegt aber nicht daran, dass Tienanmen das Regime daran erinnern könnte, dass es auch scheitern kann. Politische Opposition ist nach wie vor verboten. Nur die Intellektuellen genießen paradoxerweise mehr Bewegungsspielraum, was freilich nur ein Tribut ans Ausland sei, wie in Peking immer wieder hervorgehoben wird.
Auf den Tiananmen-Schock folgte der Anfang vom Ende von Chinas langen „Flitterwochen“ (miyue) mit den Vereinigten Staaten, die sich über fast zwanzig Jahre hingezogen hatten: Sie begannen mit der Aufnahme der Volksrepublik China in die Vereinten Nationen am 25. Oktober 1971 – Taiwan wurde damals ausgeschlossen – und der Chinareise von Präsident Richard Nixon ein Jahr später. Und sie setzten sich fort mit der „strategischen Partnerschaft“ während der Reagan-Ära. Dann folgte allerdings eine lange Reihe von Enttäuschungen und Zwischenfällen, wie die Bombardierung der chinesischen Botschaft in Belgrad im Mai 1999 und die verstärkte Zusammenarbeit der USA mit dem Erzfeind Japan.
Das zweite prägende Ereignis war der Zusammenbruch der Sowjetunion. Nicht dass der Untergang des verfeindeten Bruders Bedauern hervorgerufen hätte, doch etliche chinesische Russlandexperten weisen darauf hin, dass die UdSSR durch die aussichtslose Konfrontation mit den Vereinigten Staaten und vor allem durch den kostspieligen Rüstungswettlauf aufgerieben worden sei.
Die Lektion ist klar: „Die Vereinigten Staaten forcieren den Rüstungswettlauf und drängen zu einer Steigerung der Militärausgaben“, meint ein Militärexperte, der anonym bleiben möchte. „Wir müssen uns aber auf die Modernisierung unserer Ausrüstung konzentrieren, um unsere Verteidigungsbereitschaft zu stärken.“ Diese Bescheidenheit ist allerdings reine Rhetorik, denn die Militärausgaben liegen heute bereits bei 2,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Wobei diese Zahl der politischen Führung als gewichtiges Argument gegenüber dem Generalstab dient, der wesentlich mehr Rüstungsausgaben fordert.
Nach Meinung chinesischer Diplomaten hat sich – ganz allgemein gesprochen – die Spaltung der Welt in zwei Lager als zu kostspielig herausgestellt. Und obgleich alle die von den Vereinigten Staaten verkörperte „unipolare Welt“ beklagen, will doch niemand zum „bipolaren Planeten“ von einst zurück. So schlägt auch niemand vor, sich an die Spitze der Entwicklungsländer zu stellen, weil man davor zurückschreckt, Opfer zu bringen.
„Wir teilen mit vielen Entwicklungsländern das Anliegen, die internationalen Organisationen demokratischer zu gestalten“, meint Kong Quan und verweist auf die Bedeutsamkeit der chinesischen Beziehungen zu Afrika und Lateinamerika. „Aber einen eigenen Block zu bilden, das steht überhaupt nicht zur Debatte. Wir müssen die Mentalität des Kalten Kriegs hinter uns lassen, weshalb ich lieber von ‚gemeinsamer Entwicklung‘ spreche. Wir brauchen eine Mentalität der Verhandlungsbereitschaft, was gegenseitige Zugeständnisse voraussetzt. Mit dem Aufschwung des Handels werden auch die Meinungsverschiedenheit zunehmen. Wir müssen sie im Geist der Verhandlungsbereitschaft lösen.“
Tatsächlich will die chinesische Staatsführung am Aufbau einer multipolaren Welt mitwirken, in der China eines Tages eine herausragende Position einnehmen soll – im Zentrum, nicht an der Spitze. China komme es auf Ausstrahlung, nicht auf Beherrschung an, was keineswegs nur ein formaler Unterschied ist. Quan erinnert daran, dass China auf dem Höhepunkt seiner Macht, zwischen dem 11. und dem 17. Jahrhundert, die größte Flotte der Welt besaß und in wirtschaftlicher und technologischer Hinsicht führend war, ohne dabei jemals – wie die europäischen Kolonialmächte – andere Völker oder Zivilisationen zerstört zu haben.
Das dritte einschneidende Ereignis war, als es der chinesischen Staatsführung gelang, die Finanzkrise zu nutzen, die Asien in den Jahren 1997 und 1998 erschütterte. Damals war China das einzige Land der Region, das an einer Devisenkontrolle festhielt und sich dem Druck des Internationalen Währungsfonds (IWF) widersetzte. Damit sicherte sich die Volksrepublik ihre Wachstumschancen in einer Zeit, da alle Volkswirtschaften, die japanische inbegriffen, in die Rezession abrutschten. Dank der Dollarbindung des Yuan brachte China ein wenig Stabilität in die krisengeschüttelte Region und konnte es sich sogar leisten, einigen der angeschlagenen Tigerstaaten günstige Kredite oder Finanzhilfen zu gewähren.

Stabilitätsanker nach der Finanzkrise von 1997/98
Im Laufe der Zeit schmiedete die neue Führungsriege eine strategische Doktrin, die auf den „vier Nein“ von Staatspräsident Hu Jintao basiert: „Nein zur Hegemonialpolitik, nein zur Machtpolitik, nein zur Blockpolitik, nein zum Rüstungswettlauf.“ Sich seiner Schwächen gegenüber dem politischen Giganten USA und den Konkurrenten im asiatischen Raum bewusst, entwickelte Peking, was man als „asymmetrische Diplomatie“ bezeichnen könnte: eine äußerst bewegliche Außenpolitik, die bilaterale Beziehungen bevorzugt, gleichwohl aber aktiv an den regionalen Organisationen mitwirkt, wirtschaftliche Kontakte knüpft und überkommene territoriale Spannungen abbaut.
So unterzeichnete China mit Russland am 2. Juni 2005 in Wladiwostok ein Grenzabkommen: Dabei waren nur 2 Prozent der insgesamt 4300 Kilometer langen gemeinsamen Grenze umstritten. Doch der Konflikt hatte seit 1945 die bilateralen Beziehungen vergiftet. „Erstmals in der Geschichte der chinesisch-russischen Beziehungen ist der gesamte Grenzverlauf rechtlich festgeschrieben“, konnte Wladimir Putin am Ende der Verhandlungen verkünden.
Kurz zuvor, am 11. April 2005, unterzeichnete der indische Ministerpräsident Manmohan Singh mit seinem chinesischen Amtskollegen ein Protokoll zur Regelung der seit 1962 schwelenden Grenzstreitigkeiten: Während Peking weite Gebiete des Bundesstaats Arunachal Pradesh im Nordosten Indiens für sich reklamiert (90 000 Quadratkilometer), erhebt Neu-Delhi Anspruch auf die Kaschmirregion Aksai Chin (38 000 Quadratkilometer). „Die Gespräche haben zwar gerade erst begonnen“, erklärt Kong Quan, „aber es ist das erste offizielle Dokument, das die Grenzfrage thematisiert.“ Außerdem würde Peking mit dem nach China bevölkerungsreichsten Staat der Erde ganz gern eine Freihandelszone bilden.
Die neuerliche Gesprächsbereitschaft ist für die Beziehungen mit Chinas alten Verbündeten nicht folgenlos. Das gilt vor allem für Pakistan: „Wir verhalten uns im Konflikt zwischen Indien und Pakistan eher neutral“, erläutert Yang Baoyun, Vizepräsident des Zentrums für Asien-Pazifik-Studien an der Beida-Universität in Peking. Seiner Meinung nach hat Islamabad lange von den Spannungen profitiert, doch die Mentalitäten beginnen sich zu ändern. Das zeige sich schon an der Wiederaufnahme der Busverbindung zwischen den beiden Teilen Kaschmirs, die 60 Jahre lang unterbrochen gewesen war.
Das verstärkte „Friedensengagement“ Chinas äußert sich auch in der aktiven Rolle, die das Land in der seit Oktober 2002 virulenten Krise zwischen den Vereinigten Staaten und Nordkorea in der Atombombenfrage spielt. Von Peking ging die Anregung für die Sechsergruppe aus (China, Japan, Russland, die Vereinigten Staaten sowie Nord- und Südkorea), die versucht, mäßigend auf die Regierung in Pjöngjang einzuwirken, wobei Pjöngjang sich durch die feindliche Rhetorik der Bush-Administration allerdings eher bestätigt fühlt.
Eine Nuklearisierung der koreanischen Halbinsel lehnt Peking ab. Falls Pjöngjang Atombombenversuche machen sollte, „würden wir die Hilfe einstellen“, versichert Yang Baoyun. Umstritten ist jedoch, inwieweit man Pjöngjang unter Druck setzen sollte. Manche meinen, man könnte die Hilfe zumindest einschränken. Schließlich habe sich Staatspräsident Kim Jong Il 2004 zur Wiederaufnahme der Gespräche bewegen lassen, als man wegen eines willkommenen „technischen Zwischenfalls“ die Erdöllieferungen reduziert hatte. Experten wie Professor Shen Dingli sind dagegen der Auffassung, „eine Einstellung der Hilfe würde alle Hoffnung zerstören“ und das Regime „vollends in die Enge treiben“.
„Korea ist eine abscheuliche Altlast“, resümiert ein ehemaliger Diplomat, „ein Regime, unter dem die Menschen für den Machterhalt einer Herrscherfamilie verhungern. Aber China steckt in einer Zwickmühle und kann weder vor noch zurück.“ Ein Teil der Armee spielt allerdings mit dem Gedanken, dass eine Nuklearisierung so schlimm gar nicht wäre, da Korea dann im Konfliktfall weiterhin die Rolle eines „Wachpostens für China“ spielen würde.
Jedenfalls hat die Regierung in Peking ihren Nachbarn und auch der US-Administration gezeigt, dass sie durchaus in der Lage ist, altgediente Bündnisse zu überdenken und diplomatisch aktiv zu werden. Das gilt zum Beispiel auch für die verstärkten Beziehungen zu Südkorea: Der langjährige Verbündete der Vereinigten Staaten fürchtet eine Destabilisierung Nordkoreas und ist angesichts der Probleme, die Deutschland mit der Wiedervereinigung hat, im Umgang mit der benachbarten Diktatur vorsichtiger geworden.
Doch der größte Stachel in der Pfote des chinesischen Tigers ist und bleibt das Verhältnis zu Japan. „In den vergangenen dreißig Jahren waren die Beziehungen noch nie so schlecht wie heute“, sorgt sich Yang Baoyun. Diese Einschätzung wird von allen unseren Gesprächspartnern geteilt. Die meisten verweisen dabei auf die Weigerung Japans, sich mit der eigenen Vergangenheit auseinander zu setzen. Heftige Protesten rief zum Beispiel ein Geschichtsbuch hervor, das die japanischen Kriegsverbrechen während der Besatzung herunterspielt, desgleichen der Besuch von Ministerpräsident Junichiro Koizumi im Yasukuni-Schrein, wo zahlreiche Kriegsverbrecher begraben liegen.
Doch Chinas kollektives Erinnern ist auch nicht gerade selbstkritisch. Ein Rundgang durchs Museum von Shenyang im Nordosten des Landes – dem früheren Zentrum der japanischen Besatzungsmacht – hilft, das Trauma zu begreifen: Die Ausstellung zeigt die Morde, Folterungen und medizinischen Experimente, die die japanischen Streitkräfte seit 1931 an der chinesischen Zivilbevölkerung verübten. Daneben stehen Äußerungen japanischer Persönlichkeiten, die noch in jüngster Zeit diese Ereignisse geleugnet haben. Spricht man die antijapanischen Demonstrationen an, die im Frühjahr 2005 stattfanden und an denen fast ausschließlich Studenten, die streng überwacht werden, aber praktisch keine Arbeiter beteiligt waren, hört man in Shenyang wie in Peking häufig die Antwort: „Was würden Sie denn sagen, wenn ein führender deutscher Politiker ein Kriegsverbrechergrab mit seinem Besuch beehren würde?“
Abgesehen von den Gebietsstreitigkeiten um eine Inselgruppe, wo reiche Erdöl- und Erdgaslagerstätten vermutet werden – von den Japanern Senkaku- und von China Diaoyu-Inseln genannt –, moniert Peking die verstärkte militärische Zusammenarbeit zwischen Washington und Tokio. Kazuya Sakatomo, Professor an der Universität Osaka, beurteilt das positiv: „Nach sechzig Jahren hebt Japan sein Haupt und beginnt, Australien in der Rolle des Hilfssheriffs der USA im pazifischen Raum abzulösen. Tokio wird zu einem Pfeiler der amerikanischen Verteidigungsarchitektur im 21. Jahrhundert.“
Gestützt wird diese These auch durch die Verfassungsänderung, die den Einsatz japanischer Truppen im Irak ermöglicht hat, und die Verlagerung des Kommandos der 1. US-Armee von der amerikanischen Westküste auf die südlich von Tokio gelegene Militärbasis Zama.
Außerdem unterstützt Washington Japans Antrag auf ständige Mitgliedschaft im UN-Sicherheitsrat. Um das zu verhindern, drohte Peking bereits damit, von seinem Vetorecht Gebrauch zu machen: „Bevor Japan einen Sitz im Sicherheitsrat ins Auge fasst, sollte das Land in dieser Frage einen Konsens in der Region erreichen“, erklärte der chinesische UN-Botschafter Wang Guangya am 26. Juni. Peking kann dabei auf Südkorea als regionalen Bundesgenossen zählen. Es hat gegen die militaristischen Sympathien Koizumis ebenfalls heftig protestiert.
Und als in der überarbeiteten Fassung des bilateralen Sicherheitsabkommens zwischen Japan und den Vereinigten Staaten auch das Problem Taiwan auftauchte, erschütterte das nachhaltig das chinesisch-japanische Verhältnis. Seit der Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen nach 1972 hatte Tokio diese Frage stets ausgeklammert, während Washington die Formulierung „zwei Systeme, ein Land“ geprägt hatte. Die Eingliederung Taiwans „kann hundert Jahre dauern“, wie ein Diplomat formulierte, aber die Separation sei in keiner Weise hinnehmbar und werde weder in der Bevölkerung noch in Armee und Regierung akzeptiert.
Demnach wären die Drohgebärden der letzten Monate und das im April dieses Jahres verabschiedete Antisezessionsgesetz eher defensiver als offensiver Natur: Bis hierher und nicht weiter, will China der Regierung in Taipeh und deren Verbündeten offenbar zu verstehen geben. Schließlich wissen alle Seiten, dass eine Militäroperation politisch, diplomatisch und wirtschaftlich unverhältnismäßige Kosten verursachen würde. Dennoch gibt es auch solche Äußerungen, wie die von General Zhu Chenghu: „Wenn die Amerikaner chinesisches Territorium unter Beschuss nehmen, werden wir nicht zögern, Nuklearwaffen einzusetzen.“
Auch wenn er das als Privatmann gesagt hat, hätte man die Äußerung dementieren lassen können. Peking befürchtet offenbar, dass Taiwan die Olympischen Spiele 2008 zum Anlass nehmen könnte, seine Unabhängigkeit zu erklären. Dabei verspricht man sich ansonsten viel von den Spielen: Sie sollen zur wichtigen Etappe auf dem Weg Chinas zur dominierenden regionalen und globalen Macht werden. Daher die Drohungen, aber auch die verführerischen Angebote an die Adresse Taipehs.
Anfang Mai dieses Jahres bereitete Peking der einst befeindeten Kuomintang-Führung, die seit 1949 das chinesische Festland nicht mehr betreten hatte, einen pompösen Empfang. Die jüngste Lateinamerikareise von Staatspräsident Hu Jintao sollte zwar vor allem die Versorgung mit Erdöl (Venezuela), Rohstoffen, Getreide und Soja (Kuba, Mexiko, Brasilien) sicherstellen. Aber zugleich wollte man allen Ländern, die „noch immer enge Kontakte zu Taipeh pflegen“, vorführen, dass „China den weitaus größeren Markt“ zu bieten hat.
Um die Regierung in Taipeh unter Druck zu setzen, baut die Führung in Peking kurzfristig vor allem auf die rund 8 000 taiwanischen Unternehmer, die in China investiert haben. Die Bush-Administration schließlich hat sich dazu durchgerungen, mäßigend auf die Unabhängigkeitsträume ihres Verbündeten einzuwirken, und auch Japan hält sich neuerdings in dieser Frage zurück.
Doch in Tokio ist man zweifellos beunruhigt, glaubt ein erfahrener chinesischer Diplomat: „Historisch kannte die Region ein starkes China und ein schwaches Japan, anschließend ein geschwächtes China und ein erstarktes Japan. Inzwischen zieht China langsam wieder mit Japan gleich, weshalb Japan aus der Balance gerät.“ Die Machtverhältnisse sind in Bewegung geraten, aber von einem neuen Gleichgewicht der Kräfte ist die Region noch weit entfernt.
Gewiss, China ist in Asien der noch vor Japan wichtigste Handelspartner der Vereinigten Staaten und hält, nach Japan, die zweitgrößten Devisenreserven in der Region (vor allem in Form von US-Schatztiteln), aber das chinesische Bruttoinlandsprodukt ist noch immer um das Zweieinhalbfache kleiner als das japanische. China kann Washington drohen, seine Dollarreserven abzustoßen, doch in einem solchen Fall würde Japan sofort den Dollar stützen.
Das ungleiche Kräfteverhältnis schließt Konkurrenz nicht aus. Während Japan mit einem ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat seine Rolle als in Asien führende Weltmacht zu festigen hofft, möchte sich China der Welt als die dominierende asiatische Nation präsentieren. Daher sein Streben nach Mitgliedschaft in multilateralen Organisationen. Der Beitritt zur Welthandelsorganisation (WTO) 2001 war in dieser Hinsicht ein ganz entscheidender Schritt.
Mit der nötigen Geduld verschaffte sich Peking bereits Zugang zur Vereinigung südostasiatischer Nationen (Asean), die ursprünglich ein klassisches Instrument des Kalten Krieges war. Nachdem China – das seit 1991 Beobachterstatus hatte – im Oktober 2003 der Sicherheitspartnerschaft beigetreten ist, konnte es im November 2004 die Bildung einer gemeinsamen Freihandelszone mit den Asean-Staaten erreichen.
Pekinger Konsens als neues Entwicklungsmodell?
Die Gründung der Schanghai-Organisation für Zusammenarbeit im April 2001 dient vor allem Chinas Handelsinteressen in der zentralasiatischen Region – Stichwort „Erdöl“. Die Initiative, der außer China auch Russland, Kasachstan, Kirgisien, Tadschikistan und Usbekistan angehören, hat seit dem Afghanistankrieg eine deutlichere politische Färbung angenommen. China teilt die russischen Bedenken angesichts der US-Militärbasen in der Region und beobachtet die islamistischen Bewegungen wie die anderen Mitgliedstaaten mit wachsender Besorgnis – zumal die uigurischen Islamisten nach chinesischer Lesart langfristig nach Unabhängigkeit streben. Die Unterdrückung jedweder Opposition wie jüngst in Kirgisien stört Peking dabei in keinster Weise.
Der US-amerikanische Chinaexperte David Shambaugh resümiert: „Die bilaterale und multilaterale Diplomatie Pekings zeigte ein außergewöhnliches Geschick, sich in der Region Asien Vertrauen zu verschaffen. Infolgedessen betrachten die meisten Länder China inzwischen als guten Nachbarn, konstruktiven Partner, aufmerksamen Gesprächspartner und als eine Regionalmacht, die ihnen keine Angst macht.“
Kann man deshalb schon von einem „Pekinger Konsens“ als neuem Entwicklungsmodell sprechen, wie Joshua Cooper Ramo nahe legt, der dem Council on Foreign Relations in New York wie dem Foreign Policy Centre in London angehört? Ist China in der Lage, die wirtschaftliche und politische Führung einer asiatischen Union zu übernehmen? Auf ökonomischer Ebene reichen die Mittel dazu gewiss noch nicht aus: Zwei Drittel der chinesischen Ausfuhren stammen aus ausländischen Unternehmen, die im Lande montieren lassen, was andernorts entworfen wird.
In einigen Hightech-Sektoren sind die Chinesen zwar führend, und in anderen Sektoren versuchen sie, an die Spitze zu kommen, indem sie ausländische Forschungszentren ins Land holen und Unternehmen aufkaufen, um bekannte Marken zu übernehmen und vom Technologietransfer zu profitieren. Einstweilen aber steht das chinesische Wirtschaftswachstum auf wackligen Beinen und ist noch stark vom Ausland abhängig: in der Produktion von den Asean-Staaten und von Japan, und was die Ausfuhren betrifft, ist China auf die Märkte des Westens angewiesen. Ein Schwachpunkt ist auch das anfällige chinesische Finanzsystem. Die kleinste Missstimmigkeit, beispielsweise mit den USA, könnte die Wachstumsdynamik zum Stillstand bringen und politisch höchst explosive Folgen haben.
Dennoch träumen manche Experten von einer chinesisch-japanischen Achse nach dem Vorbild der deutsch-französischen Achse in Europa. So fand etwa zeitgleich mit den antijapanischen Demonstrationen im Frühjahr 2005 in Peking eine gemeinsame Tagung von japanischen, chinesischen und koreanischen Intellektuellen statt. Im Juni erschien in den drei Ländern ein offizielles Geschichtsbuch für die Schulen, an dem Historiker aus allen drei Nationen mitgewirkt haben. Aber solche Aktionen sind von eher marginaler Bedeutung. Zwar mögen die USA bereit sein, einen größeren Teil ihrer Funktion als militärischer Schutzschirm der Region abzugeben, doch würden sie wohl kaum eine starke Regionalmacht akzeptieren – weder Japan und erst recht nicht China.
China will zügig vorankommen – ohne dabei das Chaos heraufzubeschwören. „Ausstrahlung kann es nur gewinnen“, meint ein Diplomat, „wenn es eine attraktive Kultur vorzuweisen hat – so wie ursprünglich auch unsere Sprache. Konsumieren reicht da nicht. Wir müssen unsere eigenen Werte erfinden, die nicht bloß den Westen kopieren dürfen.“ Doch denen, die sich darum bemühen, fehle der öffentliche Raum für Diskussionen. Unser Gesprächspartner befürchtet daher, dass China mit dem Abblocken politischer Freiheiten seine eigene Entwicklung blockiert.
Aus dem Französischen von Bodo Schulze
Martine Bulard ist stellvertretende Chefredakteurin von Le Monde diplomatique, Paris. Dieser Text erschien im September 2005 in LMd.




