Die Ukrainefrage
Der Westen hat die Moskauer Feierlichkeiten zum 70. Jahrestag des Kriegsendes wegen der Ukrainekrise boykottiert. Um zu einer Lösung dieses Konflikts beizutragen, hat sich der ehemalige Minister Jean-Pierre Chevènement auf Wunsch des französischen Präsidenten bereits im Mai 2014 mit Präsident Putin getroffen. Hier beschreibt er, was seines Erachtens zum Misstrauen gegen Russland geführt hat, und zeigt mögliche Auswege.
von Jean-Pierre Chevènement
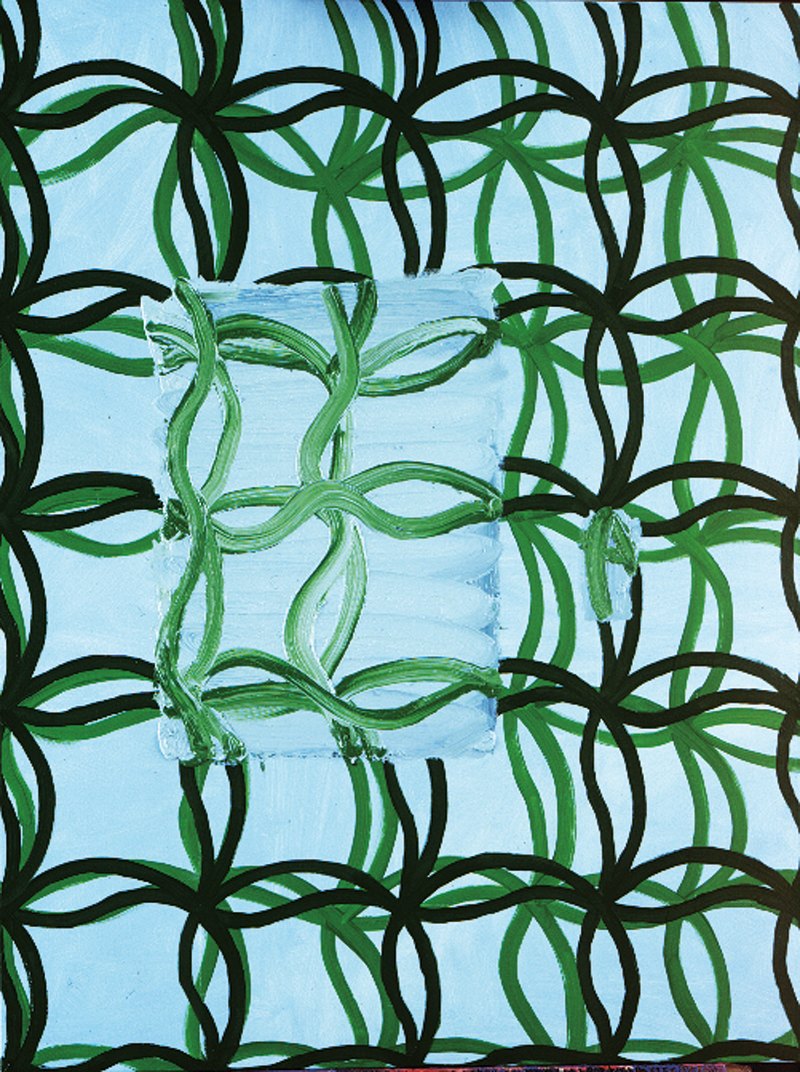
Ende 1991 beschlossen die Präsidenten Russlands, der Ukraine und Weißrusslands die Auflösung der Sowjetunion. Die vollzog sich zwar friedlich, weil Michail Gorbatschow, der letzte Staatspräsident der UdSSR, keinen Widerstand leistete, doch sie ließ gefährliche Konfliktherde entstehen.
Die UdSSR hatte bei der letzten Volkszählung von 1989 rund 286 Millionen Einwohner, von denen 147 Millionen in der Russischen Sowjetrepublik lebten. Nach der Gründung des neuen Staates lebten 25 Millionen Russen jenseits der Grenze, während es umgekehrt eine Vielzahl nichtrussischer Nationalitäten im neuen Russland gab. In manchen Regionen führte der neue Grenzverlauf zwischen den ehemaligen Sowjetrepubliken zu vermehrten Spannungen, etwa in Bergkarabach, Transnistrien, Südossetien, Abchasien und Adscharien.
Viele dieser multiethnischen Staaten hatte es vor der Gründung der UdSSR im Dezember 1922 noch gar nicht gegeben. Und die Ukraine war davor nur drei Jahre lang, von 1917 bis 1920, unabhängig gewesen. Als am 25. Dezember 1991 eine unabhängige Ukraine entstand, handelte es sich um ein zusammengesetztes Gebilde. Die westlichen Regionen hatten zwischen den Weltkriegen zu Polen gehört, während die Bevölkerung im Osten russischsprachig war. In den 1990er Jahren führten die Privatisierungen zum Aufstieg einer Oligarchenklasse, die den Staat beherrschte statt umgekehrt.
Die Zukunftsperspektive der Ukraine – zwischen Nato-Beitritt und Neutralität – hängt aufs Engste mit der Entwicklung der europäischen und globalen Kräfteverhältnisse zusammen. Schon 1997 schrieb Zbigniew Brzezinski, wenn Russland die Kontrolle über die Ukraine wiedergewinnen würde, „erlangte es automatisch die Mittel, wieder ein mächtiges Europa und Asien umspannendes Reich zu werden“.1
Vorhersehbar war die Ukrainekrise schon seit der Orange Revolution (2004) und dem ersten Anlauf zum Nato-Beitritt (2008). Doch sie wäre vermeidbar gewesen, wenn die Europäische Union die Verhandlungen über ein Assoziierungsabkommen mit der Ukraine auf die seit 2003 anvisierte EU-russische Partnerschaft, inklusive einer Freihandelszone „von Lissabon bis Wladiwostok“, abgestimmt hätte.
Die EU hätte die enge Verflechtung der ukrainischen und russischen Volkswirtschaften berücksichtigen müssen. Und sie hätte sich nicht von den Anhängern der Nato-Osterweiterung instrumentalisieren lassen dürfen. Stattdessen manövrierte Brüssel die Ukraine in die unmögliche Lage, zwischen Europa und Russland wählen zu müssen. Präsident Janukowitsch zögerte: Angesichts des attraktiveren russischen Angebots wollte er die für den 29. November 2013 geplante Unterzeichnung des Assoziierungsabkommens verschieben.
Ich weiß nicht, ob Štefan Füle, der EU-Kommissar für Erweiterung und Europäische Nachbarschaftspolitik, seine Direktiven von Kommissionspräsident Manuel Barroso bekam und ob der Europäische Rat überhaupt die Frage diskutiert hat. Präsident Putin behauptete, Barroso und Van Rompuy, der Präsident des Europäischen Rats, hätten im Januar 2014 jede Diskussion mit Russland über den Inhalt des Assoziierungsabkommens unter dem Vorwand abgelehnt, dass die Ukraine ein souveräner Staat ist.
Janukowitschs Zögern war das Signal für die Maidan-Demonstrationen, die am 22. Februar mit der Entmachtung des Präsidenten endeten. Dass viele Ukrainer von der EU träumen, ist verständlich. Gleichwohl stellt sich die Frage, ob die Kommission das Mandat hatte, für die Normen und Standards der EU jenseits ihrer Grenzen zu werben. Die Demonstranten auf dem Maidan wurden von prominenten Politikern aus Europa, und vor allem aus den USA, ermutigt. NGOs und westliche Medien starteten einen wahren Informationskrieg. Es ist fraglich, ob die offene Unterstützung der Demonstrationen, deren Ordnungsdienst vor allem von den rechtsextremen Organisationen Rechter Sektor und Swoboda gestellt wurde, nicht darauf hinauslief, das Projekt der EU mit den Initiativen der Nato oder gar der USA und ihrer Geheimdienste zu verwechseln.
Präsident Janukowitsch hat zweifellos viele Fehler gemacht, doch er war immerhin gewählt. Seine nicht verfassungskonforme Absetzung kann man als Revolution oder Staatsstreich ansehen. In Moskau entschied man sich für die zweite Interpretation. Der Anschluss der Krim an Russland – wenn auch über ein Referendum – war unbestreitbar eine überzogene Reaktion. Auch wenn die Halbinsel bis 1954 russisch gewesen war, verstößt dieser Akt gegen den Grundsatz der territorialen Integrität, den Moskau stets hochgehalten hat – zuletzt im Fall Kosovo, dessen Abtrennung von Serbien dieses Prinzip flagrant verletzt hat.
Im Fall Krim stellte Putin die strategischen Interessen Russlands im Schwarzen Meer über alle anderen Erwägungen – auch aus der Befürchtung heraus, dass die neue ukrainische Regierung den Pachtvertrag, der Russland die Flottenbasis von Sewastopol bis 2042 sichert, nicht einhalten würde. So wie Putin in die Krise eher hineingeschliddert ist, so hat auch die EU die Entwicklung zwar nicht vorausgeplant, aber durch ihre unbedachte Politik gefördert. Heute stellt sich die Frage, ob die Europäer die Situation wieder unter Kontrolle bekommen können.
Putin hatte zweifellos nicht antizipiert, dass die USA die Annexion der Krim zum Anlass nehmen würden, Sanktionen zu verhängen. Noch Anfang Mai 2014 hatte der russische Präsident seine Bereitschaft erklärt, den Konflikt zu begrenzen. Er forderte die russischsprachigen Regionen auf, eine innerukrainische Lösung zu finden. Am 10. Mai sprachen sich François Hollande und Angela Merkel für eine Dezentralisierung der Ukraine aus, die in der Verfassung verankert werden solle. Am 25. Mai wurde Petro Poroschenko zum Präsidenten gewählt und sofort von Moskau anerkannt. Am 6. Juni entstand das „Normandie-Quartett“ aus der Ukraine, Russland, Deutschland und Frankreich. Eine friedliche Lösung schien in Sicht.

Kettenreaktion von Versäumnissen und Provokationen
Kurz darauf geriet die Situation außer Kontrolle. Die Kiewer Regierung startete eine „Antiterror-Operation“ gegen die „selbst ernannten Republiken“, brachte damit die Bevölkerung des Donbass gegen sich auf und scheiterte. Am 5. September wurde das Waffenstillstandsabkommen Minsk I unterzeichnet. Sechs Tage später traten die Sanktionen der USA und der Europäischen Union in Kraft, offiziell, um die Umsetzung des Waffenstillstands zu sichern. Da die US-Sanktionen auch die Bankverbindungen mit Russland abschnitten, wurde der EU-Handel mit Russland zunehmend gebremst oder sogar lahmgelegt. Russland verkündete Gegensanktionen für den Lebensmittelhandel und wandte sich den Schwellenländern zu.
Zur selben Zeit stürzte der Erdölpreis ab und mit ihm der Kurs des Rubel: Ende 2014 war die Parität zum Dollar von vormals 35 auf 70 Rubel angestiegen. Die Waffenstillstandsvereinbarungen liefen aus. Kiew startete eine zweite Militäroffensive, die ebenfalls scheiterte. Nach erneuter Aktivierung des Normandie-Quartetts wurde am 12. Februar Minsk II unterzeichnet.
Und die Falle schnappte zu: Die westlichen Sanktionen waren eigentlich verhängt worden, um wieder aufgehoben zu werden. Während der militärische Teil des Minsk-II-Abkommens halbwegs umgesetzt wird, blieb die politische Agenda liegen. Dabei waren die einzelnen Etappen genau festgelegt: Annahme eines Wahlgesetzes durch die Rada (das ukrainische Parlament), lokale Wahlen im Donbass, Verfassungsreform, Gesetz über die Dezentralisierung, Neuwahlen und schließlich die Wiederaufnahme der Grenzkontrolle zu Russland.
Doch dann verabschiedete die Rada am 17. März ein Gesetz, das die Agenda umstieß, indem es den „Rückzug der bewaffneten Gruppen“ zur Voraussetzung machte. Die Aufhebung der Sanktionen wird damit zur Geisel in einem wahren Teufelskreis: Im Prinzip können sie nur einstimmig verlängert werden. Tatsächlich dürfte sich aber der sogenannte Konsens durchsetzen. Angela Merkel hat am 28. April 2015 bereits angekündigt, dass die EU-Sanktionen Ende Juni wahrscheinlich verlängert werden.
Was in der Ukraine stattfindet, ist ein Stellvertreterkrieg. Auf der einen Seite stehen die ukrainische Armee und die „Freiwilligenbataillone“, die von den USA und ihren Verbündeten unterstützt werden, auf der anderen die „Separatisten“, die sich auf die russischsprachige Bevölkerung stützen, und natürlich auch auf Russlands Beistand, der sich als humanitäre Hilfe ausgibt. Die Fortsetzung dieses Konflikts könnte die Ukraine zum ewigen Zankapfel zwischen der EU und Russland machen. Mit einem breit angelegten ideologischen Kreuzzug sind die USA bestrebt, Russland zu isolieren und zugleich ihre Kontrolle über den Rest Europas zu verstärken.
Die Verfechter eines neuen Kalten Kriegs beschreiben Russland als Diktatur, die ein prinzipieller Feind der universellen Werte ist und die UdSSR wiedererrichten will. Für jeden, der das heutige Russland kennt, ist diese Beschreibung überzogen, ja nachgerade eine Karikatur. Putins Popularität beruht auf zwei Erfolgen: dem ökonomischen Aufschwung des Landes, dessen Bruttoinlandsprodukt in den 1990er Jahren um die Hälfte geschrumpft war, und der Tatsache, dass er die Auflösung des Staats verhindern konnte. Putins Vision für Russland ist nicht imperial, sondern national: Modernisierung und Wahrung der Sicherheitsinteressen, wie sie jeder Staat hat.
Natürlich kann man versuchen, alte Ängste wiederzubeleben. Dummheit kennt bekanntlich keine Grenzen. Russland befindet sich mitten im Wandel. Ein wichtiges Merkmal ist der Aufstieg einer breiten Mittelschicht, in der viele gegen Putins Rückkehr ins Präsidentenamt waren, die aber nun, drei Jahre später auf seiner Seite zu stehen scheinen. Auch Gorbatschow ist der Meinung, der Westen habe Russland seit 1991 zu Unrecht als besiegtes Land behandelt, obwohl das russische Volk ein großes, offenkundig europäisches Volk sei.2 Die Tatsache, dass es im Krieg gegen Nazideutschland den höchsten Preis gezahlt hat, wird verdrängt. Wir erleben ein Umschreiben der Geschichte, als hätte der Antikommunismus den Kommunismus überlebt.
Doch die materielle Basis des Kalten Kriegs – die Konfrontation zweier wirtschaftlich und ideologisch antagonistischer Systeme – existiert nicht mehr. Der russische Kapitalismus hat zwar seine Besonderheiten, aber es ist ein Kapitalismus unter anderen. Putin will mit der Betonung konservativer Werte vor allem die Wunden schließen, die siebzig Jahre Bolschewismus der russischen Geschichte zugefügt haben. Die eigentliche Frage, um die es in der aktuellen Ukrainekrise geht, lautet aber, ob Europa in der Lage ist, als unabhängiger Akteur in einer multipolaren Welt aufzutreten, oder ob es sich mit seiner dauerhaften Unterordnung unter die USA abfindet. Die Russophobie der Medien erinnert in ihrer Einseitigkeit an den Golfkrieg 1990/91. Die Konditionierung der öffentlichen Meinung beruht auf Unbildung und Unkenntnis der heutigen russischen Realität; vielleicht handelt es sich auch um ein bewusst polarisierendes, also manipulatives ideologisches Konstrukt.
Russland demonstriert heute eine Fähigkeit zur Selbstbehauptung. Und Frankreich hat die Aufgabe, nach dem Normandie-Format, das auf seine Initiative zurückgeht, das übergeordnete Interesse Europas zu vertreten. Wir dürfen nicht zulassen, dass unsere Außenpolitik von extremen oder revisionistischen Tendenzen behindert wird. Ich persönlich setze Kommunismus und Nazifaschismus nicht gleich wie die am 9. April von der Kiewer Rada beschlossenen„Anti-Propaganda-Gesetze“. In der Ukrainekrise scheint sich Merkels konservatives Deutschland viel zu sehr nach den USA zu richten. Berlin könnte versucht sein, die traditionelle „Ostpolitik“ gegenüber Russland aufzugeben, um Zugriff auf die Ukraine zu gewinnen. 2010 gab es in der Ukraine 1800 Beteiligungen von deutschen Unternehmen, von französischen nur 50.
Die Ukraine stellt die natürliche Erweiterung des zentraleuropäischen Reservoirs an billigen Arbeitskräften dar. Das ist ein Wettbewerbsvorteil für die deutsche Industrie, die mit den Lohnsteigerungen in Mittel- und Osteuropa klarkommen muss. Deutschland muss die Europäer überzeugen, dass es nicht nur die Schaltzentrale der US-Politik in Europa ist, wie man angesichts der Instrumentalisierung des BND durch die National Security Agency (NSA) vermuten könnte. Das Normandie-Quartett muss das Instrument für die Umsetzung von Minsk II sein, mit dem der Widerstand in der Ukraine gegen den politischen Teil von Minsk II überwunden werden kann. Europa verfügt über die finanziellen Hebel.
Es wird Zeit, dass sich ein „europäisches Europa“ zu Wort meldet. Das könnte zunächst die USA davon zu überzeugen versuchen, dass ihr wahres Interesse nicht darin besteht, Russland aus dem „Westen“ zu vertreiben, sondern gemeinsam mit Russland neue Spielregeln festzulegen, die für alle Seiten akzeptabel sind. Nur so kann wieder ein Minimum an Vertrauen entstehen.
1 Siehe Zbigniew Brzezinski, „Die einzige Weltmacht. Amerikas Strategie der Vorherrschaft“, Weinheim (Beltz) 1997, S. 74 f.
2 Rede in Berlin, 9. November 2014.
Aus dem Französischen von Claudia Steinitz
Jean-Pierre Chevènement war Bildungs-, Verteidigungs- und Innenminister in verschiedenen französischen Regierungen.




