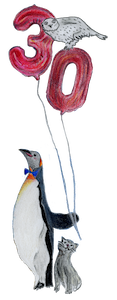Liebe, Freiheit, Paragrafen
Homosexuelle Paare zwischen Verfolgung, Anerkennung und rechtlicher Gleichstellung von Gabriel Girard und Daniela Rojas Castro
Dass sich die Lage für Lesben, Schwule, Bisexuelle und Trans-Personen1 (LGBT) insgesamt verbessert hat, wird niemand ernsthaft bestreiten. Dabei ist es noch gar nicht so lange her, dass in Spanien ein Gesetz existierte, das Homosexuelle als gefährlich einstufte (es wurde 1979 abgeschafft). Und bei der Pariser Polizeipräfektur gab es bis 1981 eine „Abteilung zur Kontrolle der Homosexuellen“.
Inzwischen wird in vielen Ländern über die Gleichstellung von Homoehen diskutiert, und der argentinische Senat hat das weltweit erste Gesetz zur Anerkennung sexueller Minderheiten ratifiziert2 – die Zeiten staatlich verordneter Diskriminierung scheinen Lichtjahre zurückzuliegen. Tatsächlich herrschen jedoch in weiten Teilen der Welt nach wie vor mittelalterliche Zustände. In etlichen Ländern müssen LGBT-Personen bis heute ein Leben im Verborgenen führen, um sich vor staatlicher Repression und gewalttätigen Übergriffen zu schützen, bei denen oft auch religiöser Fundamentalismus eine Rolle spielt.
Anfang der 1980er Jahre, nachdem die ersten Fälle der Immunschwächekrankheit Aids bekannt geworden waren, kämpften die Schwulen und Lesben im Westen vor allem um die gesellschaftliche und rechtliche Anerkennung ihrer Partnerschaften. Die meisten Infizierten konnten zunächst nicht behandelt werden; viele starben nach entsetzlichen Qualen am Kaposi-Syndrom, einer vor allem im Zusammenhang mit Aids auftretenden Krebserkrankung. Für die manchmal schon selbst infizierten hinterbliebenen Partner kam zu der Trauer die Rechtlosigkeit hinzu – ein unhaltbarer Zustand. Doch bis der sich änderte, sollten noch Jahre vergehen.
Dänemark war das erste Land, das 1989 ein Gesetz für eingetragene Partnerschaften verabschiedete. Es folgten Anfang der 1990er Jahre Norwegen, Schweden, Grönland, Island und Ungarn. In der Schweiz gilt es seit 2007. In Deutschland trat das „Lebenspartnerschaftsgesetz“ (LPartG) am 1. August 2001 in Kraft. Dieses stellt, ebenso wie das schweizerische Gesetz, die eingetragene Partnerschaft mit der klassischen Ehe weitgehend gleich, so zum Beispiel bei der Hinterbliebenenrente oder der Erbschaftssteuer – aber nicht beim in Deutschland geltenden Ehegattensplitting, das heterosexuellen Ehepaaren teils erhebliche Steuervorteile bietet. Gegen eine vollständige steuerliche Gleichstellung der Homoehe wird immer wieder damit argumentiert, dass die Ehe zwischen Mann und Frau privilegiert behandelt werden müsse, weil sie „die Fortpflanzung und den Erhalt der Generationenfolge“ sichere, so die CDU-Bundestagsabgeordnete und Präsidentin des Bunds der Vertriebenen, Erika Steinbach.
Auch bei den Themen Vaterschaft und Adoption besteht nach wie vor eine Ungleichbehandlung.3 Vorreiter wie Dänemark oder Großbritannien, wo eingetragene Partner gemeinsam Kinder adoptieren können, machen hingegen Mut, den Kampf um die Gleichstellung auch auf diesem Feld weiterzuführen.

In 78 Ländern verboten
Seit Ende der 1990er Jahre geht es nicht mehr nur um die Anerkennung, sondern um die rechtliche Gleichstellung von homo- und heterosexuellen Paaren. Nach den Niederlanden (2001) ergänzten die skandinavischen Länder ihre Gesetze in diesem Sinne. Spanien (2005) und Portugal (2010) erlaubten Ehe und Adoption. Südafrika und Kanada (2005), dann Argentinien (2010) beschlossen ebenfalls Gesetze zur Gleichstellung, ebenso einzelne Bundesstaaten in Brasilien (Alagoas), Mexiko (Distrito Federal, Quintana Roo) und den USA (Connecticut, Iowa, Massachusetts, New Hampshire, New York, Washington, Washington, D. C., und Maryland). Mehr Rechte bedeuten zugleich einen verbesserten Schutz vor Diskriminierungen. In fast zwanzig Ländern ist im Strafrecht festgeschrieben, dass sich homophobe Äußerungen strafverschärfend auswirken können.
Nach einem tiefgreifenden Mentalitätswandel sieht es trotz dieser Fortschritte noch nicht aus. Das bezeugen die Stellungnahmen der katholischen Kirche zur Homoehe oder die Äußerungen des republikanischen Präsidentschaftskandidaten Mitt Romney, der sich für das Federal Marriage Amendment starkmacht, einen Zusatzartikel zur US-Verfassung, dem zufolge nur heterosexuelle Paare heiraten dürften.
In 78 Ländern sind gleichgeschlechtliche Liebesbeziehungen verboten und werden mit Gefängnisstrafen oder sogar dem Tod bestraft. In vielen Ländern Afrikas und des Nahen Ostens hat sich unter dem Einfluss fanatischer Islamisten die Homophobie in den letzten zehn Jahren sogar verstärkt. In Saudi-Arabien, im Iran, in Jemen, Nigeria, Sudan, Afghanistan und Mauretanien steht auf Homosexualität immer noch die Todesstrafe. 2002 wurden in Saudi-Arabien drei schwule Männer enthauptet, und im Iran wurden im Juli 2005 zwei schwule Jugendliche hingerichtet, ein dritter konnte durch eine internationale Kampagne gerettet werden. Im Irak, wo Homosexualität erlaubt ist, wurden seit 2004 mehrere hundert Schwule von bewaffneten Islamisten umgebracht.4
Dabei ist Schwulenfeindlichkeit keine islamische Spezialität. Sie kommt auch in anderen Religionsgemeinschaften vor. So beschwerten sich in Uganda evangelikale Pastoren über die „Nachsicht“ eines Gesetzes, das homosexuelle Handlungen mit lebenslangem Gefängnis bestraft. Die Pastoren forderten die Todesstrafe.
In diesen Ländern werden Homosexuelle aus Angst vor der Schande manchmal sogar von ihren eigenen Verwandten angezeigt. Besonders gefährdet sind Aktivisten.5 Auch die entsprechenden Netzwerke im Internet stehen unter verschärfter Beobachtung.
Häufig wird auch behauptet, Toleranz gegenüber Homosexualität sei ein Zeichen für „Verwestlichung“. Mit diesem Argument hat die Regierung in Kamerun 2011 die finanzielle Beteiligung der Europäischen Union an Programmen zur Unterstützung der Rechte sexueller Minderheiten kritisiert. Und in Uganda wurde kürzlich mehreren internationalen NGOs die Einreise verweigert, weil sie angeblich unter jungen Ugandern „Homosexuelle rekrutieren“ würden.
Zur rechtlichen Diskriminierung „verachteter Sexualität“6 kommt die Diskriminierung bei der Gesundheitsversorgung hinzu, vor allem wenn es um HIV/Aids geht. Besonders gefährdet sind Männer, die gleichgeschlechtliche Sexualkontakte haben (MSM), ohne sich explizit als homosexuell zu bezeichnen. Für Lateinamerika und die Karibik stellt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) fest: „Während die Ausbreitung des HI-Virus bei der Gesamtbevölkerung in den meisten Ländern der Region unter einem Prozent liegt, ist sie bei Männern, die Sex mit Männern haben, fünf- bis zwanzigmal höher. Die homophob motivierte Stigmatisierung führt also zu einer Ausbreitung der Epidemie.“7 Und die Aids-Präventionsprogramme kommen bei den meisten gar nicht an.8
Viele Männer verzichten lieber auf eine Behandlung, als das Risiko einzugehen, dass Familie und Freunde davon erfahren oder womöglich noch die Behörden eingeschaltet werden. Zuverlässige Zahlen über HIV-Infektionen bei den MSM sind in vielen westafrikanischen Ländern kaum zu bekommen. In Russland leugnet sogar die eigene Regierung die Existenz einer Aids-Epidemie. Beamte machen absichtlich falsche Angaben – mit fatalen Folgen für Vorsorge und Behandlung.
Vorurteile und sexuelle Befreiung
Doch selbst in Ländern mit gut funktionierenden Gesundheitssystemen wundert man sich manchmal über die Ahnungslosigkeit und die Vorurteile des medizinischen Personals. Nicht selten machen Ärzte abfällige Witze über Schwule oder verzichten auf einen HIV-Test, weil ein Patient „nicht homosexuell aussieht oder verheiratet ist“. HIV-Positive berichten über Zahnärzte, die sie mit endlosen Wartezeiten oder zur Schau gestellten Sicherheitsvorkehrungen offensichtlich abwimmeln wollen. Lesben gehen wegen erlebter oder befürchteter Diskriminierung seltener zur gynäkologischen Vorsorgeuntersuchung, was sich wiederum auf die Ausbreitung sexuell übertragbarer Krankheiten auswirkt, wie zum Beispiel durch humane Papillomviren hervorgerufene Tumore, zu deren bösartigen Veränderungen der Gebärmutterhalskrebs gehört.
Transidentiker leiden darunter, dass ihr Abweichen von der Norm nach wie vor als „psychische Krankheit“ gilt. So steht es im wichtigsten internationalen medizinischen Handbuch „Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders“ und in den Papieren der Weltgesundheitsorganisation (WHO), die allerdings unter anderem vom Europäischen Parlament schon aufgefordert wurde, dies zu ändern.
Heute engagieren sich in erster Linie weiße, wohlhabende, männliche Städter für „Gay-health“ (oder „LGBT-health“). Und die Bewegung knüpft an 1968 an, als zunächst der Feminismus und dann die Schwulen-und-Lesben-Bewegung neue Protestformen entwickelten und die Politisierung der Privatsphäre forderten.
Die von den USA ausgegangene homosexuelle Befreiung kam schnell auch in Europa an: In England wurde 1969 die Gay Liberation Front gegründet, und in Frankreich 1971 der Front homosexuel d’action révolutionnaire (FHAR). In der Schweiz entstanden ebenfalls 1971 in Zürich, Bern und Basel „Homosexuelle Arbeitsgruppen“, und in Deutschland gründete sich nach der Uraufführung von Rosa von Praunheims Film „Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt“ bei den Berliner Filmfestspielen 1971 die „Homosexuelle Aktion Westberlin“ (HAW), in der es auch eine Frauengruppe gab, aus der 1975 das „Lesbische Aktionszentrum“ hervorging.
In den 1980er Jahren veränderten sich viele dieser Gruppen stark. Manche wurden institutionalisiert, in der Schweiz ist heute das 1993 gegründete Pink Cross die Dachorganisation der Schweizer Schwulen; andere, wie die HAW, lösten sich auf. Die Schweiz hatte bereits 1942 – als in Nazideutschland Homosexuelle verfolgt wurden – die Strafbarkeit homosexueller Handlungen aufgehoben. In Deutschland wurde der umstrittene Paragraf 175 zwar 1969 reformiert (danach waren nur noch homosexuelle Handlungen mit unter 18-jährigen Jugendlichen strafbar), aber erst 1994 aus dem Strafgesetzbuch gestrichen.
Während in Deutschland die Rehabilitierung der Opfer nationalsozialistischer Verfolgung ein politisches Thema blieb, flaute die Bewegung in Frankreich in den 1980er Jahren deutlich ab, nachdem die sozialistische Regierung unter François Mitterrand die Strafbarkeit von Homosexualität aufgehoben hatte.
Zur gleichen Zeit verschärften die konservativen Regierungen anderer Länder die Maßnahmen gegen Homosexuelle. In Großbritannien beispielsweise beschloss 1988 die Thatcher-Regierung die Clause 28, eine Gesetzeserweiterung, die Gemeinden, Schulen und Kommunalbehörden die „Förderung von Homosexualität“ verbot, was de facto zu einer Tabuisierung führte und in der Schwulen-und-Lesben-Bewegung große Ängste hervorrief. Die Clause 28 wurde erst 2003 unter Tony Blair wieder abgeschafft. In den USA waren die beiden Amtszeiten von Ronald Reagan (1980 bis 1988) durch einen besonders vorurteilsbehafteten Kampf gegen Aids geprägt.9
Das Auftreten von Aids hat die Schwulenbewegung stark verändert. Es entstanden Vereine wie Terrence Higgins Trust in England (1982), Gay Men’s Health Crisis (1982) in den USA, Aids-Hilfe e. V. in Deutschland (1983) und der Schweiz (1985) oder Aides (1984) in Frankreich. Anders als die genannten Vereine, die sich zunächst vor allem um Prävention und Krankenversorgung kümmerten, verstand sich die 1987 in New York entstandene Act Up (Aids Coalition to Unleash Power) als eine politische Organisation, die sich bald nach ihrer Gründung ebenfalls internationalisierte.
Das gemeinsame Engagement gegen die Diskriminierung hat fast so etwas wie eine Vereinskultur hervorgebracht. Es gibt Sportklubs samt Dachverband (European Gay and Lesbian Sport Federation) und regionalen Vereinen. So haben die Berliner Lesben und Schwulen, um als Schwimmteam bei den New Yorker Gay Games anerkannt zu werden, 1994 den SC Berliner Regenbogenforellen e. V. gegründet. Darüber hinaus gibt es Berufsvereinigungen, in den Großstädten Treffpunkte für Schwule und Lesben und Jugend- oder Studentenorganisationen.
Die Internationalisierung, die in Zeiten des Internets immer wichtiger wird, hat für die Schwulen-und-Lesben-Bewegung schon viel früher begonnen: Schon der New Yorker Stonewall-Aufstand10 von 1969 wurde weltweit wahrgenommen. An dieses einschneidende Ereignis erinnert jedes Jahr der Christopher Street Day, auch Gay Pride, Regenbogenparade (in Österreich) oder Mardi Gras (Australien) genannt.
Im Lauf der letzten zehn Jahre ist außerdem die Unterstützung für Homophobie-Opfer ein großes Thema geworden. Netzwerke helfen verfolgten Schwulen und Lesben bei Asyl- und Einwanderungsanträgen, Aktivisten unterstützen Emanzipationsbewegungen in den Ländern, wo Repressionen und Verbote bisher jede öffentliche Auseinandersetzung verhindert haben. So ist es zum Beispiel internationalem Druck zu verdanken, dass 2009 in Senegal verhaftete Aids-Aktivisten wieder freikamen. Derartige Kampagnen machen allerdings nur die besonders eklatanten Fälle gewalttätiger Diskriminierung publik, von den Ausschreitungen bei den Gay Prides in Belgrad oder Moskau bis zur Initiative der sechs ukrainischen Parlamentarier, die einen Gesetzentwurf einbrachten, der „Propaganda von Homosexualität“ unter Strafe stellen soll.
Rechtsextreme Kreise nutzen allerdings den Kampf gegen Homophobie für ihren ausländerfeindlichen Populismus, wie die Kontroversen um den „Homonationalismus“ zeigen.11 Unter diesem Begriff werden seit gut zehn Jahren einzelne Strömungen der westlichen LGBT-Bewegung zusammengefasst, die Zuwanderer und vor allem Muslime zur neuen Gefahr stilisieren. Auf diese Weise wird die berechtigte Sorge, dass Schwule und Lesben von homophoben Regierungspolitikern oder gewaltbereiten religiösen Fanatikern angegriffen werden, vom „Kulturkampf“ gegen die gesamte muslimische Welt vereinnahmt.
Schwule Islamfeindlichkeit
In den Niederlanden stellte der 2002 ermordete Pim Fortuyn, bekennender Homosexueller und rechtsextremer Politiker, gleichsam die Karikatur dieser Tendenz dar. Es stellt sich überhaupt die Frage, wo eigentlich die Grenze zwischen dem „progressiven“ Westen und dem vermeintlich unaufgeklärten Rest der Welt verläuft, wenn Flüchtlingen, die in ihrem Heimatland wegen ihrer sexuellen Orientierung verfolgt werden, das Recht auf Asyl verweigert wird.
Im Jahr 2007 wurden bei einem Treffen international anerkannter Menschenrechtsexperten in Indonesien die Yogyakarta-Prinzipien, eine Art LGBT-Menschenrechtsresolution, veröffentlicht.12 Sie sollen internationale Institutionen dazu bewegen, jegliche Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung und der Geschlechtsidentität unterbinden. Bei ihrer Präsentation vor den Vereinten Nationen am 26. März 2007 haben 54 Länder diese Initiative unterstützt, die in eine UN-Resolution „über Menschenrechte, sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität“ münden soll.
Interessenverbände wie die International LGBT Association (Ilga) leisten weltweit wichtige Lobbyarbeit und erreichen mit ihren Solidaritätskampagnen oft erstaunlich viel. Ein Problem ist jedoch, dass sie mit ihrer Fixierung auf die sexuelle Orientierung die Klassen-, Geschlechts- und Rassenfragen komplett aus dem Auge verlieren.
Darüber hinaus wird oft übersehen, dass in vielen Regionen außerhalb der westlichen Hemisphäre mehrdeutige Geschlechtsidentitäten mit fließenden Übergängen zum Alltag gehören. Indische Hijras zum Beispiel betrachten sich selbst weder als Mann noch als Frau. Und wo ein erkennbar schwules oder lesbisches Auftreten lebensgefährlich ist, ersetzen lokale Strategien der Emanzipation und des Widerstands das im Westen obligatorische Coming-out.
Im Widerspruch zu diesem Identitätsbekenntnis üben die Queer-Theorien seit etwa zwanzig Jahren heftige Kritik am Konzept des „natürlichen“ Geschlechts13 , das sie als soziales Konstrukt begreifen. Sie wollen stattdessen die Vielfalt und fließenden Grenzen sexueller Identität hervorheben. Die Queer-Bewegung ist radikal politisch und eng mit der globalisierungskritischen Szene verbunden, wie Queer Nation in den Vereinigten Staaten oder Pinkwatching Israel, eine von arabischen Queer-Aktivisten gegründeten Initiative, die unter anderem zum Boykott israelischer Waren aufruft, oder die trans-schwul-lesbische Gruppe Les Panthères Roses, die Anfang 2000 in Québec, Frankreich und Portugal Dependancen gründete. Ihre feministischen, antirassistischen und antikapitalistischen Manifeste und Aktionen erinnern stark an die Protestbewegungen der 1970er Jahre.
Damals ging es den organisierten Lesben um die Eroberung autonomer Räume. Das war vor allem eine Reaktion auf die frauenfeindliche Stimmung in den gemeinsamen Gruppen mit Schwulen. Daneben gab und gibt es natürlich nach wie vor strategische Allianzen in gemischten Vereinen. In den 1990er Jahren gründeten Trans-Personen selbst organisierte Gruppen, was wiederum eine Reaktion auf die zunehmend kritisierte schwule Dominanz in der LGBT-Bewegung war.
Im Kampf um die sexuellen Rechte droht die Frage nach der sozialen Gerechtigkeit aus dem Blickfeld zu geraten. Viele Schwule, Lesben und Trans-Personen haben nicht nur keinen familiären Rückhalt, sondern sie sind auch mehr als andere von staatlichen Sparmaßnahmen betroffen. Gerade im globalen Süden hat sich infolge der Wirtschaftskrise die Situation verschärft, wohingegen die Schwulen und Lesben im urbanen Establishment des Nordens heute keine Angst vor Diskriminierung mehr haben müssen.
Der rosa Block gegen Sozialabbau
Doch für die anderen – Frauen, Trans-Personen und die Armen, insbesondere die Jungen unter ihnen, die weder Geld noch Ausbildung haben – ist das Leben noch komplizierter geworden. So schließen sich in vielen Ländern oft Pink Blocks den Demonstrationen gegen Sparmaßnahmen an. Andere Gruppen engagieren sich innerhalb der Gewerkschaftsbewegung oder gründen eigene Initiativen wie etwa in Großbritannien die „Queers Against the Cuts“.
Das Engagement für rechtliche Gleichstellung muss dem Kampf für soziale Veränderungen nicht im Wege stehen – im Gegenteil. Aber an ebendieser Schnittstelle muss die LGBT-Bewegung zeigen, dass sie sich verändert und neue Bündnisse zulässt. So könnten die Debatten über den Homonationalismus14 neue Perspektiven eröffnen.
Außerdem wäre es womöglich heilsam, die Hegemonie der weißen Schwulen aus dem Norden infrage zu stellen. Denn wenn die Grenzen der „gemeinsamen Interessen“ erst einmal benannt sind, könnte sich ein Raum eröffnen, um gemeinsame Ziele abzustecken und neue Bündnisse zu schmieden. Wenn man den Kampf gegen Unterdrückung und für mehr Rechte mit dem Willen vereint, ein ungerechtes System zu ändern, könnte die Mobilisierung des Südens neue politische Strategien hervorbringen.